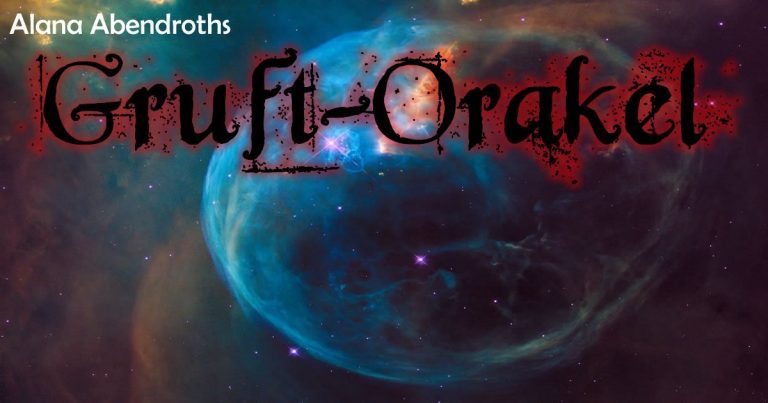Im Londoner „Timeout“ Magazin wird in der aktuellen Ausgabe gerade darüber berichtet, wie sich Gothics der Hauptstadt aus den Gräbern erheben. Autorin Alice Saville hat sich allerdings eingehender mit dem Thema beschäftigt, als ich zunächst gedacht hatte und er ist einfach zu gut, um ihn in einer Wochenschau zwischen anderen Links zu verstecken. „Gothic ist immer ein Symptom für schwierige Zeiten. Zunehmender Nationalismus, die Lebenshaltungskostenkrise, die Pandemie… die Jugendkultur ist wieder im Kommen, weil es Rebellion ist, Freude und Schönheit in der Dunkelheit zu finden.“ Zeit für einen Reaktions-Artikel.
London galt in den frühen 80er-Jahren als Brutstätte der „Goth Culture“, weil sich nahezu alle stilprägenden Bands hier herumtrieben oder gründeten und das Batcave, einen legendären Nachtclub im Stadtteil Soho, als ihr Wohnzimmer betrachteten. Von hier schwappte die Subkultur letztendlich auf das europäische Festland und zog auch hier Jugendliche in ihren Bann. Lange Zeit war es still um Londons Gothics, jetzt widmet man ihnen einen Artikel.

Die Autorin stellt zunächst fest, dass dieses Jahr eine ganze Reihe von Büchern veröffentlicht wurden, die der „Goth-Kultur“ ein Denkmal setzen. John Robbs „The Art of Darkness“ oder Lol Tolhursts Werk „Goth“ buhlen um die Gunst der Leserschaft, während Wednesday Addams in Netflix Remake einen viralen „Goth-Tanz“ zeigt, der bei jungen TikTokern eine ganze Welle von Nachahmungen auslöste. „Tausende von TikTokern ahmten ihren Todesblick und ihre wild fuchtelnden Gliedmaßen nach, in einem ironischen, aber herzlichen Akt der Meuterei gegen eine zunehmend sterile Kulturlandschaft.“ Ich bin mir fast sicher, dass weder Jenna Ortega noch Lol Tolhurst oder John Robb etwas mit Rebellion gegen eine sterile Kulturlandschaft meutern, aber zumindest haben sie das Thema „Goth“ wieder in die Medien gebracht haben. Allerdings hat die gruselige und verstaubte Vergangenheit für die Londoner Goths der Neuzeit, wie Parma Ham und Dahc Dermut VIII einer weniger wichtige Bedeutung:
Kann Gothic im Jahr 2023 wirklich wiedergeboren werden, schaurig wie eh und je? Londons Gruftis glauben das auf jeden Fall, denn sie finden neue Wege, um eine 50 Jahre alte Subkultur aus dem Grab auferstehen zu lassen.
Das Lebensgefühl
Sie wollen nicht die Politik verändern, sondern sehnen sich offenbar nach Wertschätzung für das Ausleben der eigenen Kreativität. Das fühlt sich für die beiden nach einer Rebellion gegen eine Gesellschaft an, die versucht, jeden Funken von Kreativität in vorherbestimmt Bahnen zu leiten. Diese Weisheiten unterscheiden sich allerdings nicht von der vermeintlich verstaubten Vergangenheit, sondern sind die im Grunde die Fortführung ebendieses Lebensgefühls, wie ich finde.
Jedenfalls sind sie sich sicher, dass es in ihrer gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Soho, in dem auch einst das Batcave zu finden war, spukt. Hier arbeiten sie an verstörenden Skulpturen, die sie aus Haushaltsgegenständen fertigen und machen sich für gemeinsame Ausflüge in das Londoner Nachtleben zurecht.
„Einst strömten die Goths nach Camden wie die Aasgeier zu einer Leiche: Heute ist die Szene zersplittert, aufgeteilt in einmalige Nächte im angesagten East Londoner Club FOLD, in der Colour Factory oder im Electrowerkz, das seit 1987 dunkle Nächte veranstaltet. Dermur scherzt: „Wir kommen immer und überall zu spät, weil es offensichtlich sehr, sehr lange dauert, bis wir uns fertig gemacht haben – am Ende teilen wir uns immer Make-up und Kleidung. Ihre aufwendigen Kostüme aus monochromer Gesichtsbemalung, Lederriemen, Netzstrümpfen, Nieten und hochgesteckten Haaren (Ham muss sich oft auf den Boden eines Taxis legen, um ihre Hochsteckfrisur zu schützen) haben etwas nackt-theatralisches an sich. Aber Dermur besteht darauf, dass Gothic nicht nur ein Kostüm ist, sondern eine Lebenseinstellung.“
Er kleidet sich rund um die Uhr als „Goth“ – isst, atmet und lebt diesen Lebensstil, bis die Authentizität aus allen Poren dringt. Für den 57-jährigen Grufti, der ursprünglich aus Illinois stammt, ist es eine Abrechnung mit der eigenen Vergangenheit, wie er betont. Ihm geht es darum, seine eigene Stimme zu finden und seine eigene Wahrheit zu leben.
London bleibt meiner Ansicht nach ein Fluchtort. Niemand nimmt explodierende Miet- und Lebenskosten in der britischen Hauptstadt in Kauf, weil London ein besonders lebenswerter Ort ist. Im Gegenteil. London ist ein kultureller Schmelztiegel, der viel Inspiration und möglicherweise auch Selbsterkenntnis bietet, während er dir mit seinen Lebensumständen jede Energie aus den Gliedern saugt. Du gehst nach London, weil du was erreichen willst oder etwas suchst und bleibst dort hängen, wenn du es nicht schaffst oder nicht fündig wirst. Böse gesprochen.
Verwesende Klänge
„Früher konnte man den Soundtrack eines Gothic-Clubs vorhersagen, lange bevor man seine Türen öffnete: Bauhaus, Siouxsie, Killing Joke, die unglücklich benannten Sex Gang Children… und vielleicht eine Prise Marilyn Manson Flamboyanz in den 00er Jahren. Aber die aktuelle Generation der Goths erweitert ihren klanglichen Horizont.“
Tatsächlich wird der Gothic-Sound stets erweitert. Ebenso wie, es die Cosmic Caz im Artikel beschreibt, wird der Sound technoider und experimenteller. „Dark Techno“ der den eher gruseligen Teil der 90er-Hardcore und Trance-Szene wiederbelebt, ist ebenso eine Spielart wie „Nu-Goth„, der vor allem über TikTok und Instagram Verbreitung fand. Allerdings bleibt das nicht ohne Reibungspunkte.
Die Leute schützen die Musik, mit der sie aufgewachsen sind, und wollen Gothic oft als einen bestimmten Sound definieren“, sagt Ham, „aber Gothic ist nicht rebellisch, wenn man dieselbe Musik hört, die schon die Eltern hörten. Wir müssen uns weiterentwickeln und neue Sounds kreieren, und das sollte bedeuten, dass man die Älteren verärgert.
Dark Roots
„Die Goth-Kultur kämpft derzeit mit einem schwerwiegenden Paradoxon. Das Internet erleichtert es heute mehr denn je, auf die dunkle Seite zu wechseln und über Nacht zu Experten für deren Klänge und Ästhetik zu werden. Gleichzeitig gibt es aber immer weniger Orte, an denen man sich in die einladende Düsternis des Gothic einhüllen kann.“
Die Szene ist raus aus der Pubertät, ist nicht nur erwachsen geworden, sondern mittlerweile überaltert. Außerdem kämpft das, was John Robb in seinem Nostalgie-Schinken „The Art of Darkness“ beschreibt, gegen den Zeitgeist an. Es wird nie mehr so werden wie früher. Keine geheimen Grufti-Treffpunkte, kein Verlangen mehr sich wöchentlich in dunkle Höhlen zu begegnen. Auch die Musik ist nur einen Klick entfernt und das Internet bestimmt, was unter dem Label „Goth“ zu finden ist. „Entdeckungen“ sind den Algorithmen der Streaming-Dienste unterworfen.
Freya Beer, die in auf „Islington Radio“ eine ganz eigene Interpretation einer „Gothic-Disco“ zusammenmixt, schert sich nicht um Konvention und mischt sich eine ganz eigene Version von „Gothic“ zusammen. Leider führt das, was dort zu hören ist, weit weg von einer Stimmung, die Musik aus und für die Szene einfach haben sollte. Oder ist das jetzt schon wieder ein zu „alte“ Sichtweise?
Stichwort alte Sichtweise, es gibt weitere – wenn auch wenige – Passagen des Textes, denen ich überhaupt nicht beipflichten kann:
„In den 1980er Jahren gab es in London unzählige Subkulturen in feuchten besetzten Häusern, in denen junge Leute von der Sozialhilfe leben und ihr ganzes Leben einer Szene widmen konnten: Heute bedeutet eine veränderte wirtschaftliche Landschaft, dass Subkulturen an den Rand gedrängt werden. Dennoch findet Robb Hoffnung in der globalen Renaissance des Gothic, denn „in Großbritannien neigen wir dazu, all diese brillanten Kulturen zu schaffen und sie dann zu vergessen, während der Rest der Welt sie sich zu eigen macht“.“
Tatsache ist doch, dass junge Londoner immer in feuchten (wenn auch nicht besetzten) Wohnungen leben, weil sich die Mieten der Hauptstadt nicht leisten können und sich darüber hinaus mit verschiedenen Jobs über Wasser halten müssen, weil ihnen kaum noch Sozialhilfe zusteht und der Brexit für ein wirtschaftliches Vakuum sorgt. Dahin gehend hat sich also nicht viel geändert. Oder irre ich mich? Ja, da hat John Robb vielleicht recht. Die Briten haben ein Talent dafür, Dinge, die sie mit den Händen aufgebaut haben, mit dem Hintern wieder einzureißen.
Die Gegenwehr des Mainstreams
„Dennoch gibt es einige Hindernisse, die dem Gothic-Stil im Weg stehen, während er die Welt mit einer Flutwelle aus schwarzer Spitze und verschwitztem Kunstleder überschwemmt. Der weltweit zunehmende soziale Konservatismus, der die Gothic-Bewegung so attraktiv macht, bedeutet auch, dass die Machthaber ihr Bestes tun, um Inhalte, die sie als grenzüberschreitend betrachten, zu unterbinden. Jenna Ortegas „Mittwochstanz“ mag auf TikTok zum viralen Hit geworden sein […] Aber die Moderatoren der Plattform entfernen in der Regel Videos, in denen Wörter wie „Tod“ oder „töten“ vorkommen […] Auf Instagram werden Beiträge, die Nacktheit, Blut oder beängstigende Bilder enthalten, mit großer Wahrscheinlichkeit gebannt und die Axt fällt nicht gleichmäßig. Wenn du queer bist, oder POC, oder anderweitig an den Rand gedrängt wirst, ist es wahrscheinlicher, dass der Algorithmus dich versteckt,“ sagt Caz. Man verschwindet einfach.“
Wow. Dieses Thema ist spannend und könnte wohl stundenlang diskutiert werden. Ich versuche es in aller Kürze.
Der Kampf gegen die Regulierungen, die im Internet für den besagten Konservatismus sorgen, ist meiner Ansicht nach der Kampf gegen die sprichwörtlichen Geister, die man gerufen hat. Das Internet macht die Dinge, die sonst in Nachtclubs und Ausstellungen stattfanden, einer großen Öffentlichkeit zugänglich. Während eine künstlerische Fetisch-Show in den 80er-Jahren in einem von Türstehern bewachten Club stattfand und höchstens von Fotografen festgehalten wurden, die später in der Dunkelkammer ihre Bilder entwickeln mussten, finden Dinge, die man heutzutage bei Instagram inszeniert, auf dem – überspitzt gesagt – Kinderspielplatz statt. Jeder kann sie sehen. Es ist klar, dass das zu Regulierungen führt. Die schießen allerdings meist über das Ziel hinaus und folgen den gesellschaftlichen Moralvorstellungen, gegen die die Subkultur natürlich rebellieren will.
„Die Online-Welt wird immer mehr zensiert“, sagt Ham, der sich auf Instagram eine große Fangemeinde aufgebaut hat, obwohl seine Beiträge regelmäßig gesperrt werden. Wir beschränken so viel von der menschlichen Erfahrung auf das, was für einen 12-Jährigen geeignet ist, obwohl wir alle erwachsen sind. Als Subkultur ist die Gothic-Szene in dieser Hinsicht ziemlich am Arsch.“
Im Internet kollidieren Moralvorstellung und Kunst. Möglicherweise ist Instagram eben keine Ausstellungsfläche, die einen Schutzraum für den Auszustellenden bietet.
Darüber hinaus sind in den letzten 30 Jahren auch die künstlerischen Grenzen der ästhetischen Rebellion stets nach oben verschoben worden. Logisch, schließlich wächst auch gleichzeitig die gesellschaftliche Akzeptanz. Ein Superhelden-Film der 2023 für Kinder aber 12 Jahren ist, wäre damals gnadenlos zensiert worden.
Endlose Evolution
Ich schließe mich dem versöhnlichen Ende dieses großartigen Artikels an. Es ist schön zu sehen, welche Probleme, Entwicklung und Geschichte man herausarbeiten kann, wenn sich nicht im ewig gleichen Sing-Sang über den vermeintlichen „Untergang“ der Szene echauffiert. Wenn man das eigene subkulturelle Endlichkeitsgefühl darauf schiebt, die Szene sei tot.
„Anstatt den Gothic als aus dem Grab auferstanden zu sehen, sollten wir ihn vielleicht als eine weitere der regelmäßigen Entwicklungen betrachten, die den Kern seiner fünf Jahrzehnte währenden Geschichte ausmachen. Goth überlebt, weil er sich immer wieder wandelt“, sagt Dermur. Ich finde es toll zu sehen, wie die Kids die Szene aufmischen und ihr eine neue Richtung geben, und wie Teenager neben 50-, 60- und sogar 70-Jährigen feiern. Ham stimmt dem zu. Gothic ist so tief in der Vergangenheit verwurzelt, aber genau das treibt mich an, ihn neu zu erfinden, ihn wieder interessant zu machen.„
 Weihnachten 1988. In der festlichen Atmosphäre stehen die Bedeutung von Familie, Zusammenhalt und der Wunsch nach einem Neuanfang im Vordergrund. Für die Charaktere ist dieser Abschnitt geprägt von tiefgreifenden Entwicklungen. Die Serie nimmt sich sensibel und authentisch Themen wie Drogenabhängigkeit, familiäre Konflikte, Liebe und Verlust an. Die Charaktere werden in ihrer menschlichen Komplexität und Verletzlichkeit dargestellt, und wir erleben mit ihnen ihre Höhen und Tiefen. Woody startet voller Tatendrang eines neues Leben, das allerdings so gar nicht zu ihm passt, Lol kämpft mit ihren Dämonen und Shaun manövriert seine Beziehung mit Smell an den Abgrund.
Weihnachten 1988. In der festlichen Atmosphäre stehen die Bedeutung von Familie, Zusammenhalt und der Wunsch nach einem Neuanfang im Vordergrund. Für die Charaktere ist dieser Abschnitt geprägt von tiefgreifenden Entwicklungen. Die Serie nimmt sich sensibel und authentisch Themen wie Drogenabhängigkeit, familiäre Konflikte, Liebe und Verlust an. Die Charaktere werden in ihrer menschlichen Komplexität und Verletzlichkeit dargestellt, und wir erleben mit ihnen ihre Höhen und Tiefen. Woody startet voller Tatendrang eines neues Leben, das allerdings so gar nicht zu ihm passt, Lol kämpft mit ihren Dämonen und Shaun manövriert seine Beziehung mit Smell an den Abgrund. Shaun ist mittlerweile 19. Smell hat sich von ihm getrennt und er scheint immer noch verloren nach seinem Platz in der Welt zu suchen. Nach den dramatischen Ereignissen von „This is England ’88“ versuchen Lol und Woody eine stabile Beziehung aufzubauen. Die Beziehungen zwischen den anderen Hauptfiguren werden vertieft, und die Dynamik der Gruppe wird auf die Probe gestellt. Die Serie fängt die Stimmung der 1990er Jahre ein, insbesondere die aufkommende Rave-Kultur, und thematisiert die sozialen und politischen Veränderungen dieser Ära. Ohne zu viel vorwegzunehmen, endet „This is England ’90“ mit einer bewegenden Mischung aus emotionalen Höhepunkten und Herausforderungen für die Charaktere. Aufgeteilt in 4 Jahreszeiten führt die Serie Jugendkultur, Jugendliche und ein ganzes Land aus den 80er-Jahren in ein neues Jahrzehnt.
Shaun ist mittlerweile 19. Smell hat sich von ihm getrennt und er scheint immer noch verloren nach seinem Platz in der Welt zu suchen. Nach den dramatischen Ereignissen von „This is England ’88“ versuchen Lol und Woody eine stabile Beziehung aufzubauen. Die Beziehungen zwischen den anderen Hauptfiguren werden vertieft, und die Dynamik der Gruppe wird auf die Probe gestellt. Die Serie fängt die Stimmung der 1990er Jahre ein, insbesondere die aufkommende Rave-Kultur, und thematisiert die sozialen und politischen Veränderungen dieser Ära. Ohne zu viel vorwegzunehmen, endet „This is England ’90“ mit einer bewegenden Mischung aus emotionalen Höhepunkten und Herausforderungen für die Charaktere. Aufgeteilt in 4 Jahreszeiten führt die Serie Jugendkultur, Jugendliche und ein ganzes Land aus den 80er-Jahren in ein neues Jahrzehnt.