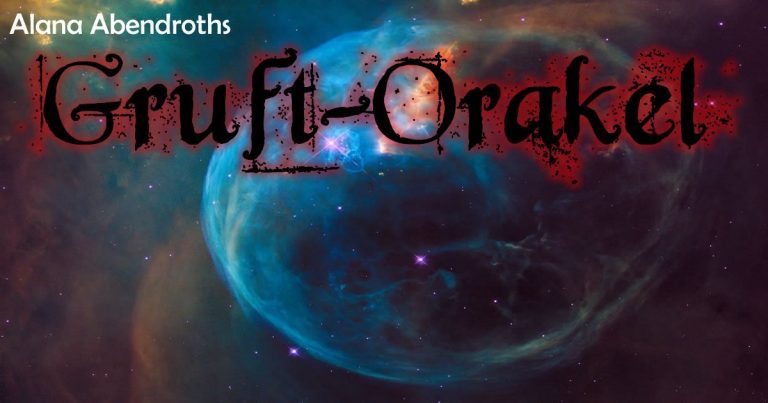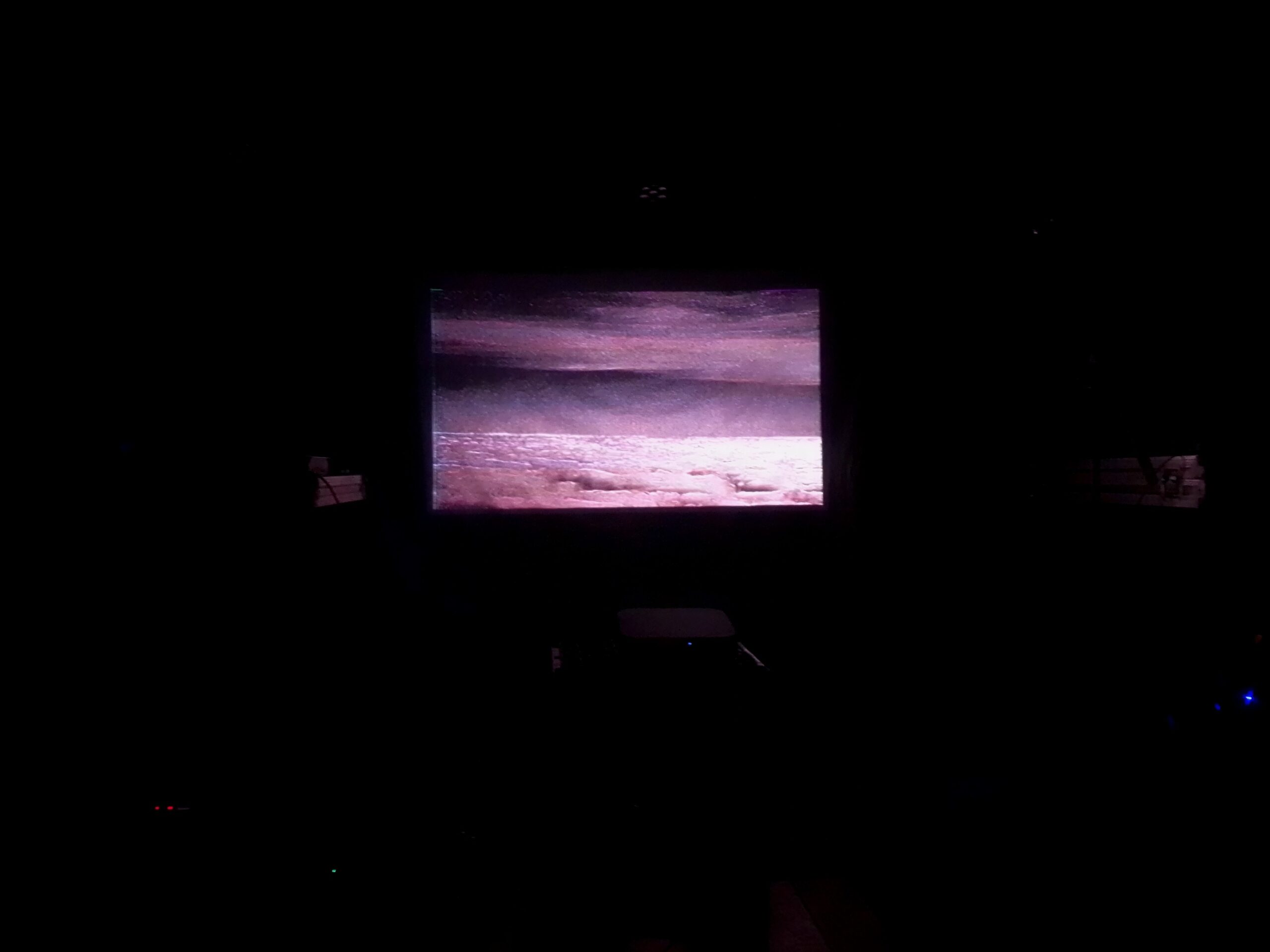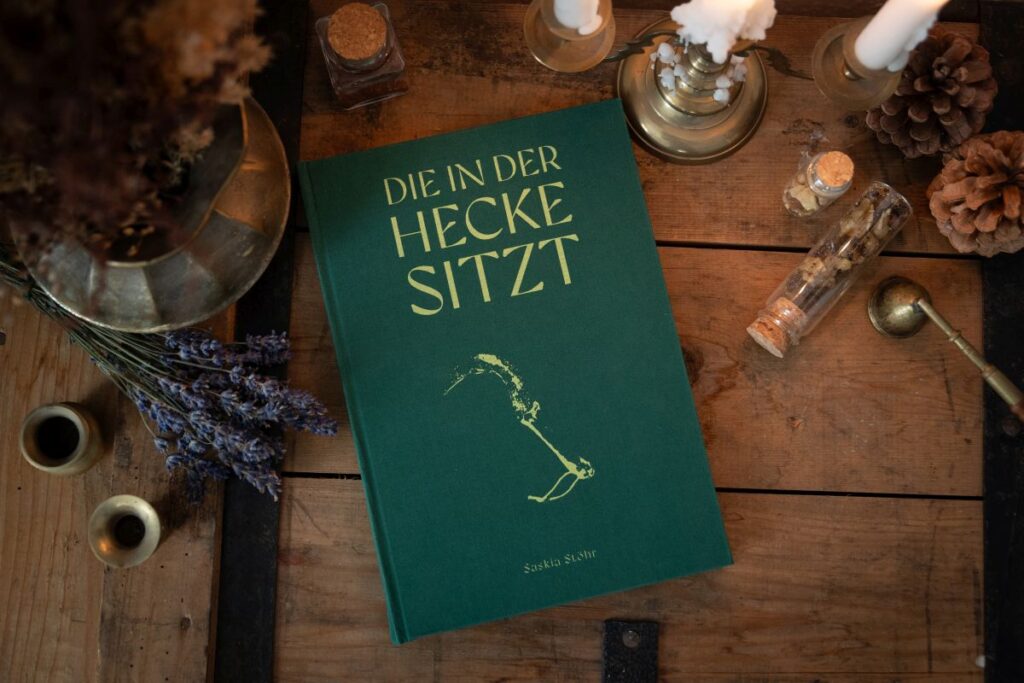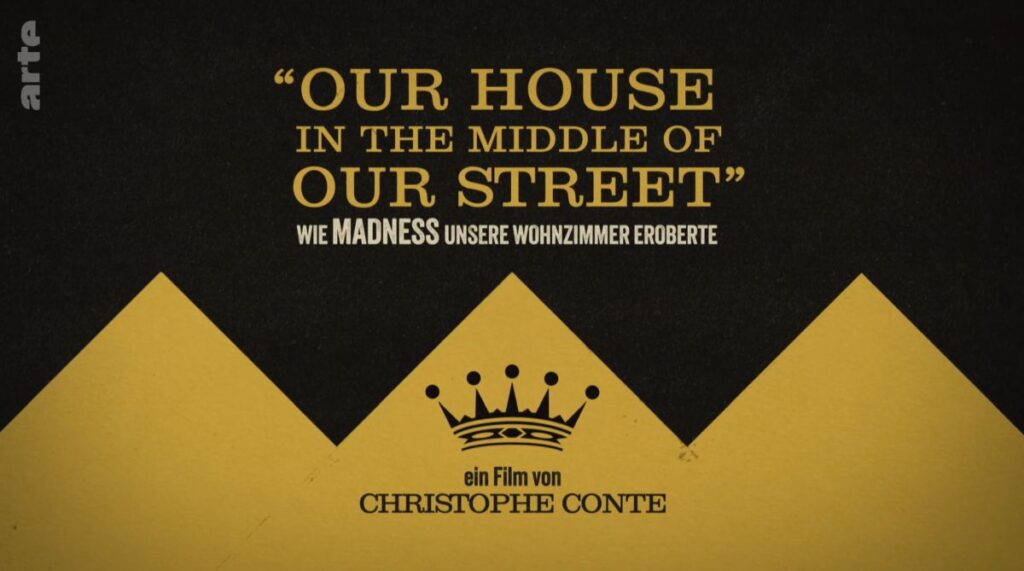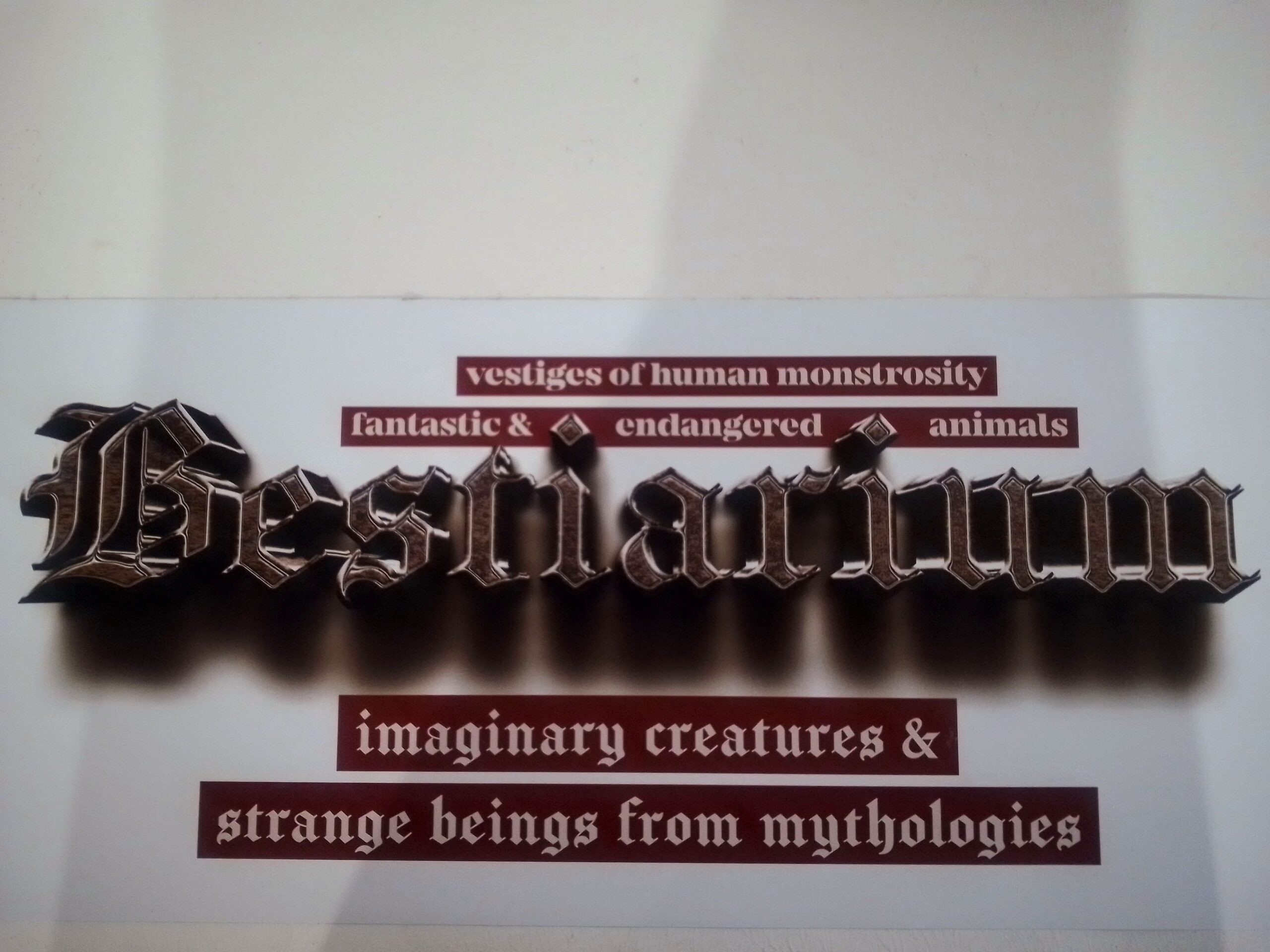Auf den Dancefloors der Republik mag Geschlechterparität herrschen. Doch oben hinterm DJ-Pult stehen immer noch deutlich mehr Männer als Frauen. Da bildet die Gothic-Szene keine Ausnahme. In Ostwestfalen ist Sally Shadowplay eine der wenigen Frauen, die auf schwarzen Veranstaltungen auflegt. Franky Future sprach mit der Paderbornerin über Macho-Gehabe, Gothic-Queens und die Szene in Portugal. Denn dort ist sie aufgewachsen.
Sally, Du bist eine der ganz wenigen Frauen hier in der Region, die auf schwarzen
Veranstaltungen auflegt. Was ist Deine Erklärung dafür, dass es so wenig weibliche DJs gibt?
Sally Shadowplay: Ehrlich gesagt, weiß ich selbst nicht so genau, woran das liegt. Ich habe da nur Vermutungen. Vielleicht liegt es daran, dass viele Frauen die Technik scheuen. Möglicherweise fehlt es aber auch an der Leidenschaft für Musik.
Du scheinst beides zu haben. Technisches Know-how und genügend Leidenschaft. Wie hat bei dir alles angefangen?
Bei mir hat alles bereits mit zwölf Jahren angefangen. Da war ich großer The-Cure-Fan. Das Auflegen habe ich mir später selbst beigebracht. Ich habe mir die nötigen Geräte angeschafft und ganz viel geübt, bis ich das hinbekommen habe. Erst habe ich analog aufgelegt mit Vinyl und CDs. Später digital. Das ist für mich natürlich viel praktischer, weil ich jetzt nicht mehr so viele Koffer mit mir rumschleppen muss. Für mich ist das DJ-Dasein wirklich eine Leidenschaft. Wenn ich auflege, bin ich in meiner ganz eigenen Welt. Ich hab übrigens vor einer Partynacht keine Playlist. Ich schaue mir das Publikum an und entscheide dann spontan, in welche musikalische Richtung es geht. Von Track zu Track. Dann gibt es mal mehr Electro oder mehr Dark Wave.

Was rätst Du anderen Frauen, die gerne mal hinter den Turntables stehen möchten?
Ich glaube, Frauen müssen wirklich einfach nur diese Hemmung vor der Technik überwinden. Sie sollten sich einfach trauen. Und wenn sie sich das Auflegen nicht selbst beibringen können oder möchten, könnten sie vielleicht andere DJs fragen. Wenn eine Frau wirklich die Leidenschaft für Musik und die Clubnächte mitbringt, dann klappt das auch.
Erlebst Du auch mal Sexismus oder Mansplaining als weiblicher DJ?
Ja, immer wieder. Du kannst Dir nicht vorstellen, was ich mir als Frau schon alles anhören musste. Da kommen Männer auf mich zu, die ganz selbstverständlich anfangen, meine Geräte anzuschließen, weil sie davon ausgehen, dass ich das nicht kann. Es gibt auch Männer, die denken, dass ich an dem Abend nur auf Play drücke und dann eine fertige Playlist abgespielt wird. Solche Kommentare höre ich regelmäßig.
Wie kamst Du auf Deinen Künstlernamen Sally Shadowplay?
Ich habe früher viel Indie und Britpop gehört. Und da gab es dieses Lied „Sally Cinnabon“ von den Stone Roses. Ein Typ meinte zu mir, dieser Song sei doch für mich gemacht worden und er nannte mich von da an immer Sally. Ich denke, er war in mich verliebt. Irgendwann haben andere den Namen übernommen. Eigentlich heiße ich Teresa. Aber kein Mensch nennt mich mehr so. Shadowplay? Na hey, das kommt natürlich von Joy Division.
Dein musikalischer Schwerpunkt liegt auf Post Punk, Gothic, Synth-Wave, Dark Electro. Was begeistert Dich an diesen Genres?
Diese Art von Musik entspricht meiner Seele und meinem Way of Living. Es ist nicht nur die Musik. Es ist alles was dazugehört. Ich fühle mich wohl in dieser schwarzen Szene seitdem ich mit zwölf Jahren The Cure für mich entdeckt habe. Ich mag aber auch andere Subkulturen. Psychobilly zum Beispiel, die Mods, die Skinheads, also „the good ones“. Aber unsere Subkultur, die Gothic-Szene, ist natürlich die Schönste. Da kann ich ich selbst sein.
Legst Du anders auf als Männer? Achtest du zum Beispiel darauf, weiblichen Musikern eine Plattform zu geben, indem Du sie spielst?
Nein, da mache ich keinen Unterschied. Mir geht es um die Musik. Die Melodie und die Lyrics müssen stimmen. Ob das von einem männlichen oder von einem weiblichen Interpreten stammt, spielt für mich beim Auflegen keine Rolle.
Der Song „Girls Gang“ von Dina Summer mausert sich gerade zum Szene-Hit. Darin geht es um weibliche Vorbilder in der Gothic-Szene. Welche Gothic-Queen imponiert Dir oder hat Dich geprägt?
Das Lied finde ich gar nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Aber die Leute können es sich trotzdem gerne bei mir wünschen. Auf die Frage nach einer Gothic-Queen fällt mir natürlich sofort Siouxsie Sioux als erstes ein. Die finde ich als Frau und als Künstlerin mega.
Du bist unter anderem in Portugal aufgewachsen. Wie sieht die schwarze Szene dort aus?
Tja, Grufties in Portugal – die Szene in Portugal ist sehr klein. Aber es gibt in Lissabon und Porto immer noch ein paar wenige Clubs, in denen düstere Musik gespielt wird. Hier in Deutschland ist dagegen Gothic-Paradise. Hier kann man an jedem Wochenende irgendwo tanzen gehen. Das geht in Portugal nicht. Aber ich habe eine Empfehlung. Jedes Jahr im August findet in Leiria das Extramuralhas-Gothic-Festival statt. Da spielen richtig coole Bands. In diesem Jahr sind unter anderem And Also The Trees, Suicide Commando, Then Comes Silence und Darkways dabei. Die kleine Stadt Leiria liegt zwischen Lissabon und Porto und ist wirklich sehenswert. Wer Urlaub in Porto macht, sollte Barrakuda Clube de Roque abchecken und den Hardrock-Club. Dort finden alternative Konzerte und Partys statt.
Wo kann man Dich demnächst als DJane erleben?
Aus gesundheitlichen Gründen lege ich nicht mehr so oft auf. Ich bin chronisch krank und kann nicht mehr sechs Stunden am Stück hinter dem DJ-Pult stehen. Aber in der Akka in Paderborn sorge ich hin und wieder für die Musik.