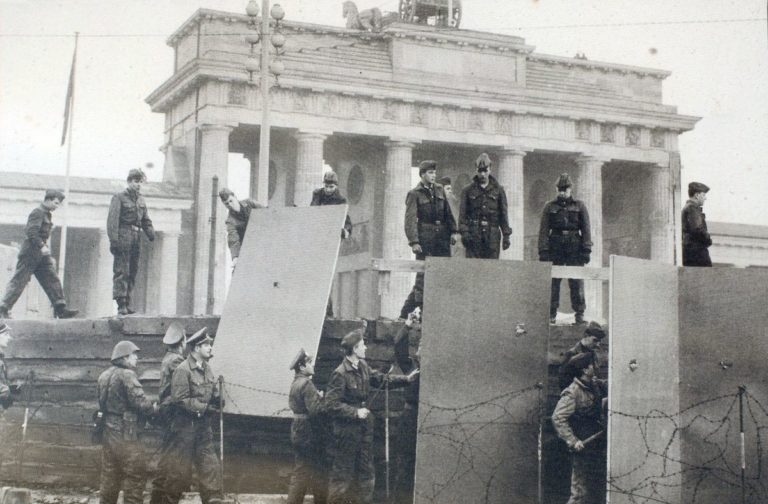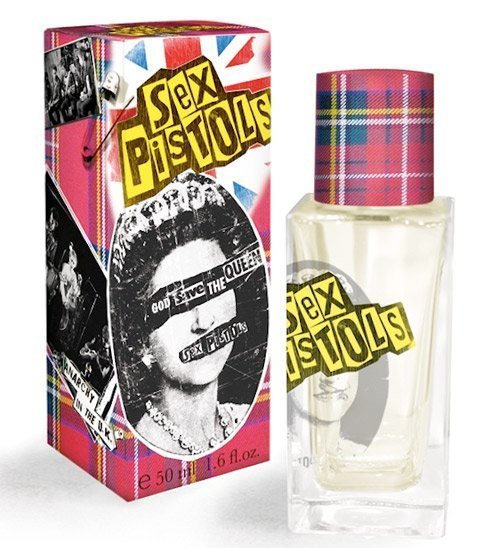Das christliche Kreuz ist ein Symbol mit sehr bewegter Vergangenheit. 431 machte das Konzil von Ephesos das seit seiner Einführung verbreitete Symbol des Christentums zu seinem Erkennungszeichen. Im christlichen Glauben ist ein Zeichen der Identifizierung und steht seit der Kreuzigung Christi als Symbol für „das gläubige Hinnehmen von Tod, Leiden und Opfern“ , aber auch für die Erlösung und die Hoffnung auf Heilung. Das Kreuz ist ein Symbol für den Tod und von ein Folterinstrument aus der Antike abgeleitet, an dem Jesu von Nazaret aufgehängt wurde, um seinen Tod hinauszuzögern. Das wird vor allem auf Kruzifixen deutlich, die den gekreuzigten Christus in „künstlerischer“ Weise darstellen.
Die Beweggründe sich mit Kreuzen zu schmücken sind ebenso vielfältig wie die Verwendung. Die Gothics tragen das christliche Kreuz vor allem als Halskettenanhänger, es wird aber auch in Form von Ohrringen, Piercings oder Tätowierungen verwendet. Die klassische Trageform des Kreuzes ist vor allem seit den frühen 80ern populär geworden und hat schon zu dieser Zeit eine vielschichtige Bedeutung. Für einige war es immer schon der Ausdruck ihres Glaubens, jedoch lassen Kreuze im Umkehrschluss keinerlei Rückschlüsse auf die religiöse Ausrichtung des Trägers zu.
Zum modischen Accessoire wurde das Kreuz zu Beginn der 80er, als es beispielsweise von Madonna (Like a Virgin) oder Billy Idol (Sweet 16) zum Bestandteil ihres Outfits gemacht wurde und so eine zunächst religiös losgelöste Renaissance erlebte. Gerade in der Gothic-Szene war das eine willkommene Überschneidung mit morbider Ästhetik die man von Friedhöfen, alten Kirchen und Gemäuern kannte und wurde so zum Verstärkung eines möglichst „toten“ Kleidungsstils genutzt.
Es lässt sich definitiv kein Zusammenhang zwischen dem Kreuz als Schmuck und der Weltanschauung des Trägers ableiten. Es gibt durchaus Gothic die sich der christlichen Kirche zugehörig fühlen und das Kreuz als Symbol ihres Glaubens tragen, es gibt aber auch Gothics für die das Kreuz Ausdruck für ihren Umgang mit dem Tod ist – für viele aber auch nur Schmuck oder Provokatives Mittel ihrer Einstellung.
Als man sich in den Folgejahren intensiver mit der religiösen Bedeutung des Kreuzes auseinandersetzte und man auch okkulte und mystische Grenzbereiche erforschte, wurde das Kreuz häufig in abgewandelter Form getragen. Das umgedrehte Kreuz als Symbol für Gegnerschaft, Fall und Sturz des Christentums das so auch erstmals im 18. Jahrhundert als Zeichen für Satanismus verwendet wurde. Mehr zum umgedrehten Kreuz, das man auch Pertruskreuz nennt, findet ihr im Artikel Schwarze Symbolik – Umgedrehtes Kreuz. Die breite Masse der Gothics sind nie Satanisten gewesen, ihre jugendliche Neugier in den Grenzbereichen religiösen Glaubens wurde jedoch häufig als solcher ausgelegt. Einzelfälle bestimmten immer wieder die Medienlandschaft und vermitteln ein falsches Bild, der tatsächliche Anteil bekennender Satanisten in der Gothic-Szene dürfte sehr gering sein, ein Auseinandersetzung mit dem Satanismus in literarischer Form ist weiter verbreitet.
Zu Beginn der 90er tauchte man dann auch in die ägyptische Mythologie ein und entdeckte das Henkelkreuz, den Ankh (Schwarze Symbolik – Ankh) für sich. Ursprünglich aus der ägyptischen Hieroglyphe für ankh (Leben) abgeleitet und daher auch Lebensschleife genannt, wird es von den Gothics häufig als Ausdruck von Lebenskraft oder Unsterblichkeit genutzt. Mit dem ägyptischen Symbol greifen die Gothics auch auf eine Verwendung des Kreuzes als Symbol zurück, das nicht mit der christlichen Geschichte zusammenhängt, sondern einen sehr viel älteren Ursprung aufweist.
Fazit
Die Gothic-Szene lädt seit über 30 Jahren das Kreuz mit den unterschiedlichsten Bedeutungen auf, die Darstellung aller möglichen Interpretationen würde den Rahmen sprengen. Es wird jedoch deutlich, das man nicht von getragener Symbolik auf die Weltanschauung des Einzelnen schließen kann. Im Einzelfall sollte man daher fragen ohne dabei eine eigene Assoziation zwischen dem Kreuz und seinem Träger herzustellen. Man sollte jedoch nicht enttäuscht sein, wenn es viele „schwarze“ nur tragen weil es gut zum Outfit passt, oder weil sie damit Reaktionen ihres Umfeldes auslösen wollen ohne sich mit Hintergründen auszustatten.
Man sollte jedoch auch als Beobachter von seinen etablierten Ansichten Abstand gewinnen, denn das Kreuz ist mitnichten ein rein christliches Symbol und allein in seinem Ursprung als Folterinstrument Jesu Christi sehr fragwürdig in seiner Verwendung. Während es die Ägypter als Lebenszeichen nutzen, steht es im Christentum zunächst für den Tod. Diese Verwendung ist auch heute noch geläufigsten, ein Kreuz neben einem Datum beispielsweise verweist auf den Todestag der entsprechenden Person, ein Kreuz in der Erde markiert die Stelle, an der ein Verstorbener beigesetzt wurde. Das Kreuz dient den Gothics als äußerliches Zeichen der Allgegenwärtigkeit des Todes und nicht als Symbol eines Glaubens und ist neben einem beliebtem Schmuckstück auch eine gewünschte, provokative Überschneidung der Ansichten des Trägers und des Beobachters.