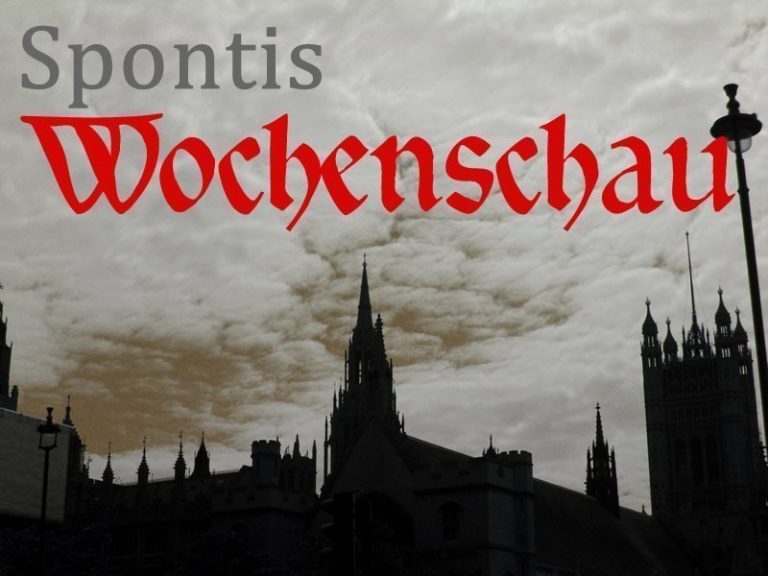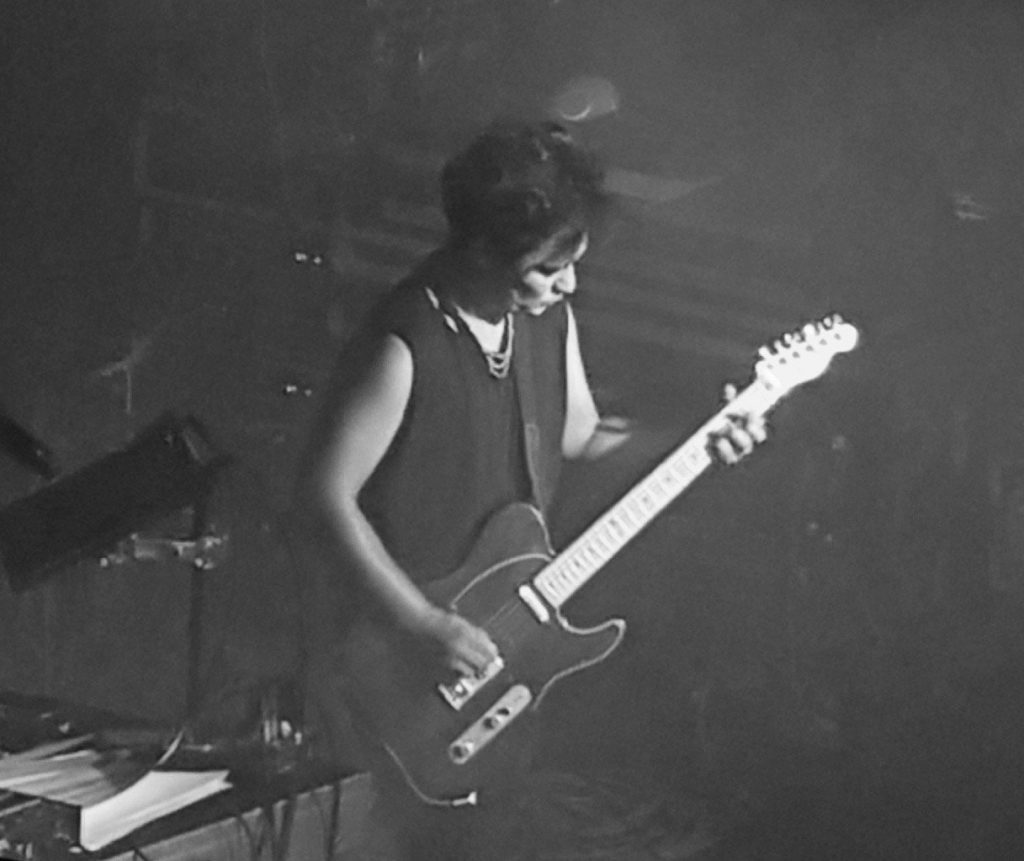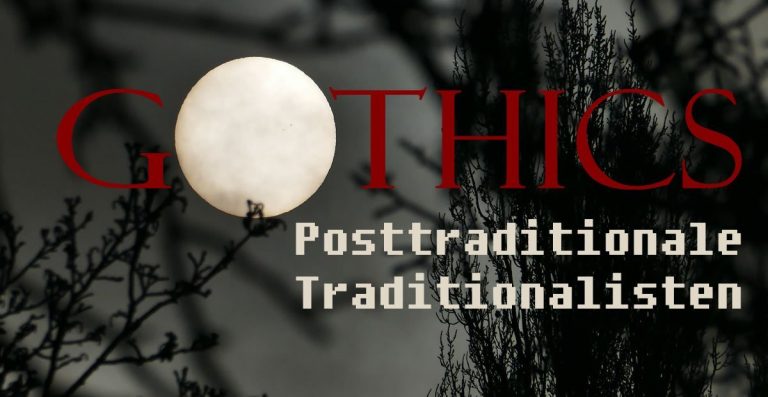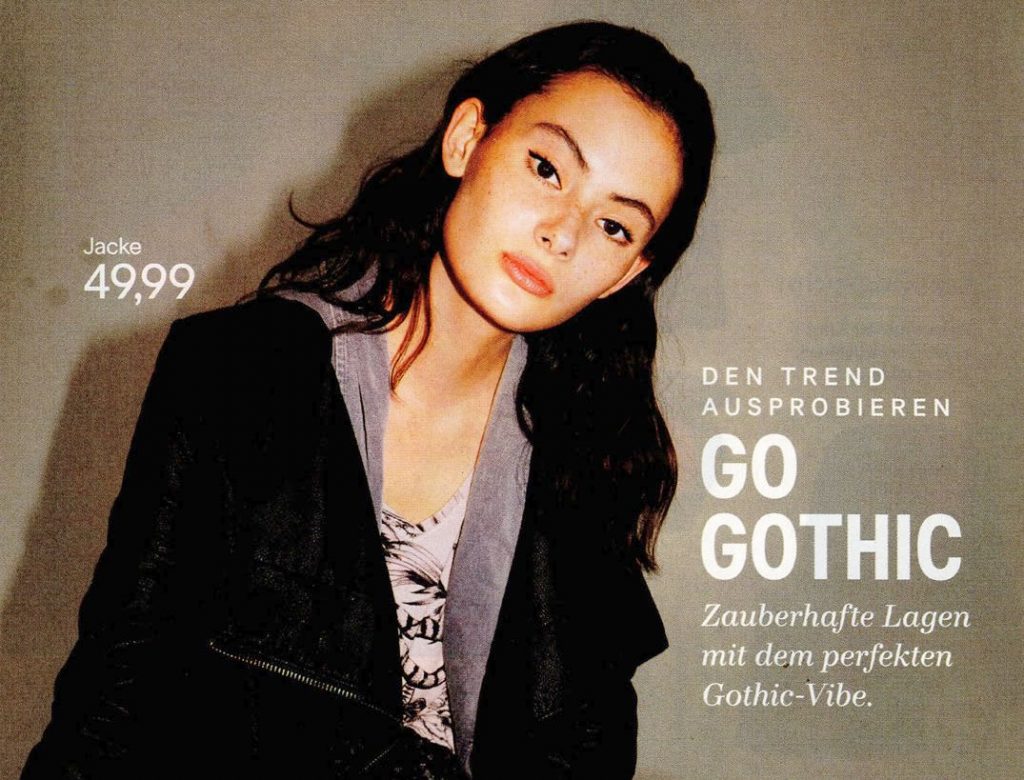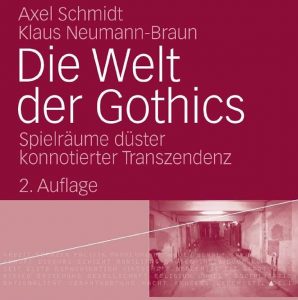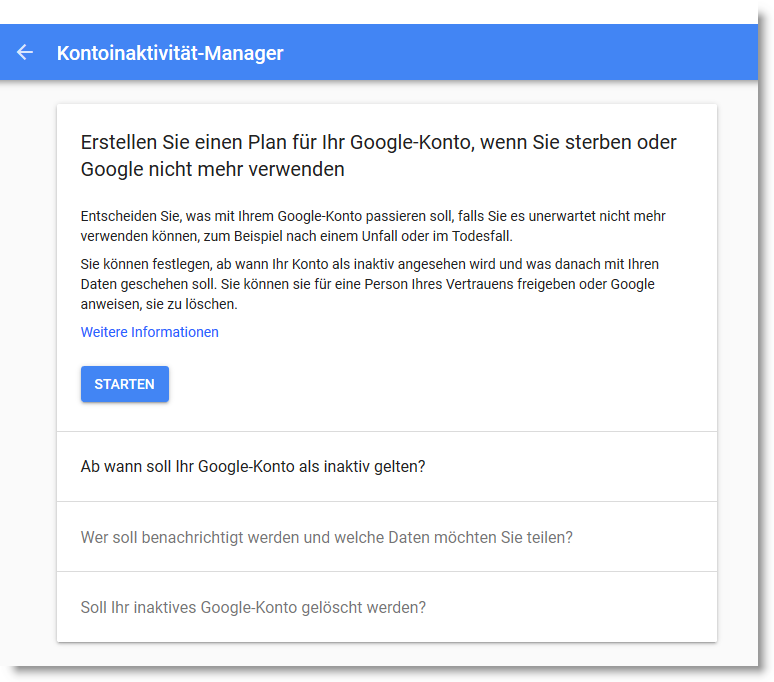Dass die Szene sich musikalisch nicht mehr weiterentwickelt und es nichts Spannendes mehr zu entdecken gibt, ist ein Unkenruf, der sich schon sehr lange und sehr hartnäckig hält. Wenn man nicht sehr viel Zeit damit verbringt oder verbringen kann, sich im digitalen Netz durch zahlreiche Seiten zu klicken und neue Musik anzuhören, mag man das meinen. Dabei ist das Netz ist voll mit neuer Musik. So voll, dass man sich gar nicht mit allem befassen kann, was musikalisch, szenebezogen und brandneu ist.
Zum Glück gibt es andere, die sich dieser Aufgabe leidenschaftlich und engagiert stellen. So wie das Netlabel und Music Promotion Service Cold Transmission (bandcamp / mixcloud). Das Label bietet neuen Projekten aus den Bereichen des Post-Punk, Coldwave, Shoegaze, New Wave, Goth, Industrial und Darkwave eine Plattform, sich und ihre Musik zu präsentieren. Das Herzblut, dass da drinsteckt müsste förmlich aus dem Bildschirm quellen, erschreckt aber andere Passanten in der Bahn, von daher muss das folgende Interview reichen um der Musik in Ohr und Herz zu verhelfen.
Spontis: Wer ist Cold Transmission?
Andreas: Cold Transmission sind Suzy – meine Ehefrau und mittlerweile CT-Geschäftsführerin – oder auch das „Herz“ hinter allem was nicht unmittelbar mit der Musik zu tun hat (Merch, Vertrieb, Bandcamp-Shop). Yvonne, unsere Grafikerin und langjährige Freundin. Sie setzt alles Design-mäßige bei CT (T-Shirts, Logos, Mixcover usw.) um. Ihr großartiges Design-Talent ist mittlerweile ein Eckpfeiler unseres Erfolgs geworden bzw. war es von Anfang an. Und ich bin wohl der musikalische Mastermind, A&R und DJ hinter allem. Wir sehen uns als unabhängig, unpolitisch und weltoffen.
Spontis: Wie kamt Ihr dazu Cold Transmission ins Leben zu rufen?
Andreas: Das war wohl meine Idee, da ich ständig auf der Suche nach neuen Bands und Songs bin. Dieser Leidenschaft gehe ich jetzt schon fast vierzig Jahre nach. Angefangen hat das Anfang der 80er Jahre mit klassischen Bands wie Depeche Mode, Ultravox, Gary Numan und vielen mehr und aktuell gipfelt das bei Bands wie The Actors, Bootblacks, Delphine Coma, Silent Runners, Crying Vessel und vielen mehr. Es kommt einfach sehr viel Gutes, Neues nach und wir möchten diese Bands sehr gerne mit unserem Musikprojekt fördern und bekannter machen. Begonnen hat es damit, dass wir Mixe über Mixcloud hochgeladen haben, was wir auch heute noch regelmäßig tun, um der Szene neue Songs zu präsentieren, die bis dahin alle auf der Festplatte schlummerten. Hier hauptsächlich mit neueren Bands, auch wenn sich mal der ein oder andere „Klassiker“ darin wiederfindet. Dies hat großen Anklang gefunden und auch dazu geführt, das Bands uns gerne neue Songs zur Verfügung stellen, die wir dann in die Mixe aufnehmen und präsentieren. Anschließend ging dann alles rasend schnell – dann war der Name da (eine Mischung aus Cold Wave und Transmission, natürlich auch eine Anspielung auf eine der Wurzeln dieser Musik), das Design, die Social Media Profile, Bandcamp und die Zeitgeist Sampler.

Aus dem Wunsch heraus für uns auch ein T-Shirt zu haben, kreierte Yvonne das erste Design, den „Sehtest“. Das Design erinnert den Sehtest bei dem man erkennen soll, in welche Richtung der kleine Kreis geöffnet ist – auch eine Anspielung an die vielen Stilrichtungen, die es in unserer Szene gibt. Kaum gepostet, wollten viele Leute dieses Shirt auch haben – mit Bands haben wir auch häufiger einen „Trikot-Tausch“ gemacht; das macht sehr viel Spaß – auch die Fotos, die wir von Bands mit dem Shirt geschickt bekommen sind klasse und bereichern unsere Profile im Netz. Das Shirt haben wir mittlerweile weltweit versendet – von Europa über Nord- und Südamerika bis nach Australien. Und daraus ist nun auch der Merchandise Shop auf Bandcamp entstanden.
Aktuell ist es ein ambitioniertes Hobby, das wir mit viel Herzblut und Leidenschaft neben unseren Hauptberufen ausüben. Wir sind sehr glücklich darüber, was wir in der kurzen Zeit erreicht haben und dass das Projekt so vielen Leuten aus der Szene (weltweit) und auch so vielen Bands gefällt und diese es auch als Plattform sehen größere Bekanntheit zu erlangen. Wir lieben was wir tun und ich denke, dass merken auch die Leute und die Bands. Wenn man etwas mit Leidenschaft macht und dies auch ausstrahlt, wird man authentisch und letztendlich vielleicht auch erfolgreich.
Es kommt uns sehr auf das Zwischenmenschliche an. Wir pflegen sehr enge Kontakte zu den Bands und bauen unser Netzwerk stetig aus, da wir auch sehr gerne auf Festivals und Konzerte gehen. Dieser Aspekt ist uns trotz aller zusätzlichen Arbeit sehr wichtig. Social Media ist hierbei natürlich ein Hauptfaktor, um in Kontakt zu treten. Inzwischen werden wir auch in Bandkreisen weiterempfohlen, so dass wir hier auch häufig angeschrieben werden. Es ist ein Geben und Nehmen zwischen den Bands und uns – zwischenzeitlich sind hier auch engere Freundschaften entstanden; ein sehr schöner Nebeneffekt.

Spontis: Und die „Zeitgeist“-Sampler?
Andreas: Die Idee zu den „Zeitgeist“-Samplern via Bandcamp entstand durch den Kontakt zu den Bands und durch den laufenden Austausch mit ihnen – auch aus dem Wunsch heraus mehr zu machen, als die Mixcloud Shows und einen Schritt weiter zu gehen. Viele der Bands waren von Anfang an gerne dazu bereit Ihre Musik über uns promoten zu lassen und überließen uns gerne einen oder mehrere Songs – manche auch exklusiv. Den Ertrag den wir durch den Verkauf erzielen, stecken wir wiederum in den Erwerb von neuer Musik – so schließt sich dann der Kreis wieder. Demnach unterstützt die Szene sich selbst ein bisschen durch Cold Transmission. Ein schöner Gedanke „Solidarität“, der gar nicht genug geschätzt werden kann.
Spontis: Welche Pläne habt ihr und welche Ziele verfolgt ihr für die Zukunft?
Andreas: Eröffnung unseres Merchandise-Shops auf Bandcamp und die ersten „Fulltime Alben“ -Veröffentlichungen als Netlabel im Sommer / Herbst diesen Jahres. Aktuell sind das die Bands Reconverb (Dänemark), ICY MEN (Ukraine) und Push Button Press (USA). Dabei kommt es uns darauf an unterschiedliche Musikrichtungen zu präsentieren (Dark Wave, Cold Wave, Post-Punk, New Wave, Retro-Wave usw.) Etwas weiter in der Zukunft sehen wir das Projekt als Plattenlabel mit physischen Releases wie z. Bsp. CDs, Vinyl usw. Ausserdem möchten wir mit dem Projekt auch weiterhin Konzerte und Partys veranstalten, was wir aktuell zusammen mit unseren Freunden der Disorder Cologne im Kölner Blue Shell machen – Im Januar gibt es hier das nächste Event mit Ash Code, Bragolin und Nao Katafuchi. Eine erste eigene Cold Transmission Party haben wir Ende Juni bei uns in Frankfurt auch schon veranstaltet. Die Ideen gehen uns also nicht so schnell aus.
Toll wären auch Kooperation mit anderen DJs und Bands im Ausland, denn wir sehen Cold Transmission als internationales Projekt. Der weltweite Zuspruch bestätigt das bei Mixcloud und auch bei Facebook. Mal sehen wo die Reise hingeht…
[mixcloud https://www.mixcloud.com/coldtransmission/cold-transmission-presents-cold-stars-vol-3-nachtplan-special/ width=100% height=120 hide_cover=1]