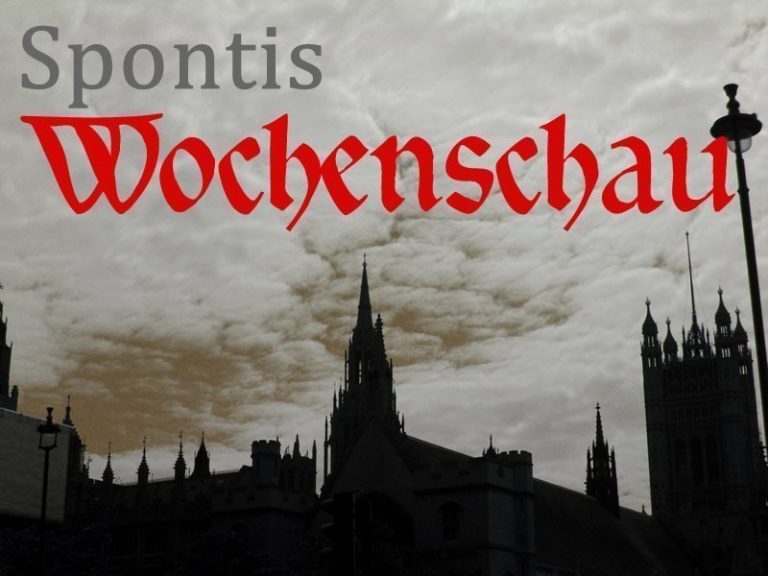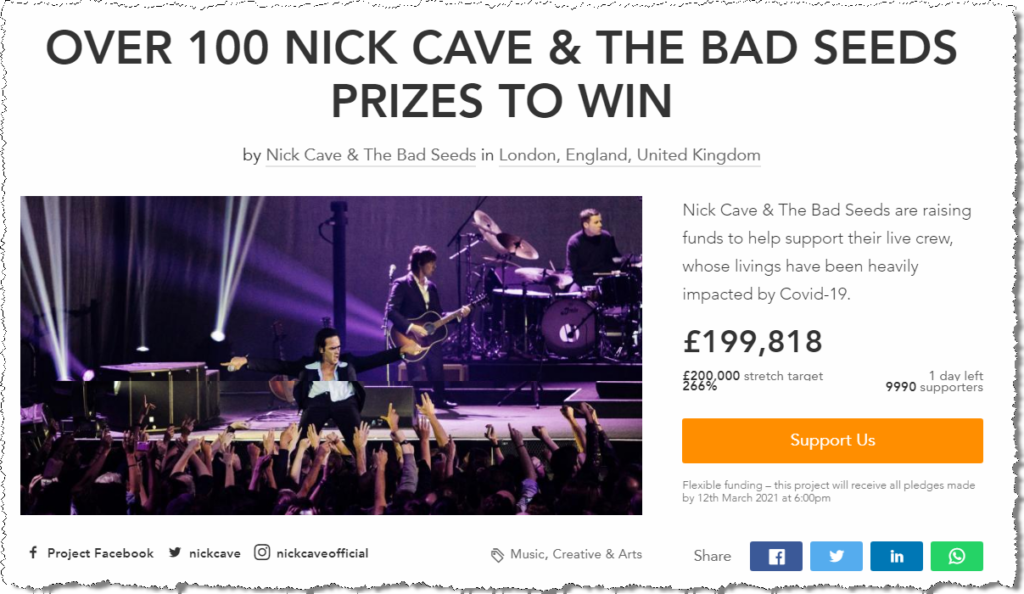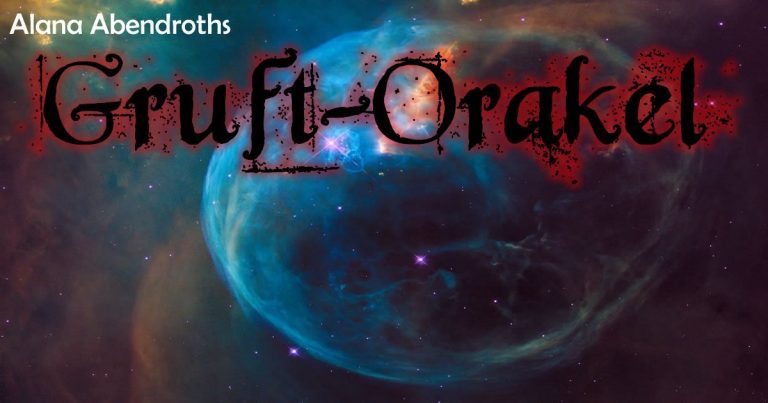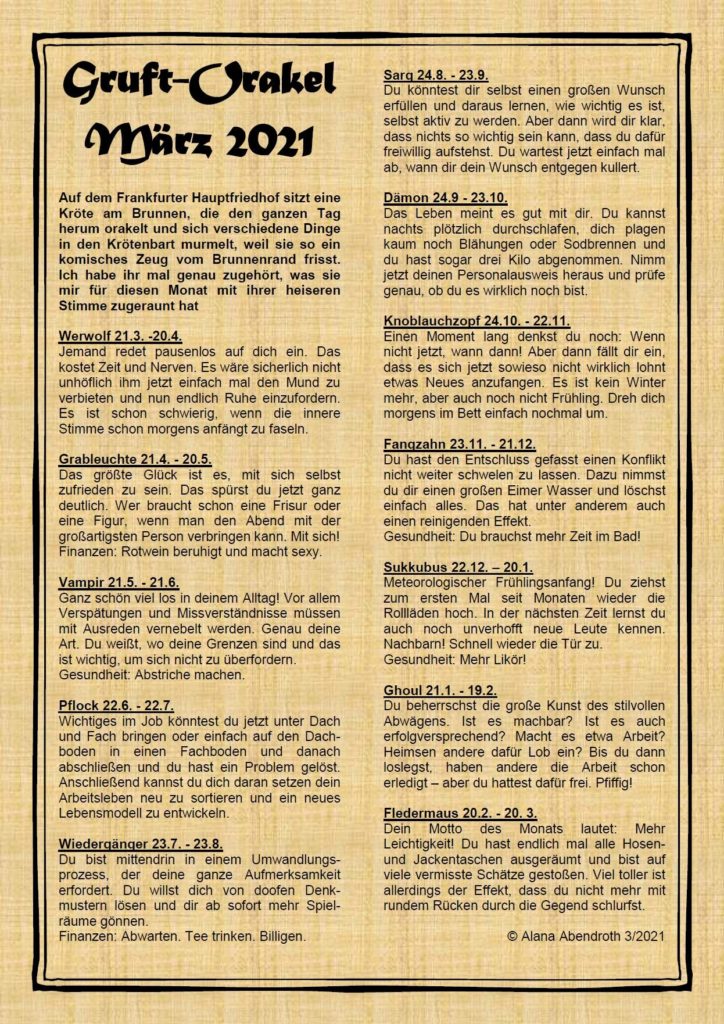Nach 14-jähriger Bandpause sind die No Angels wieder zurück auf der Bühne. Tatsächlich gestehe ich hiermit vor rund 21 Jahren „Popstars“, die Casting-Show aus der sich die Band zusammensetzte, verfolgt zu haben. Warum? Habe ich verdrängt. Ich vermute eine ausgeprägte Sinnsuche als Mitt-Zwanziger, der irgendwo zwischen Loveparade und Thunderdome Anschluss suchte und dabei eigentlich immer noch heimlich Gothic hörte. Die No Angels (bis auf Vanessa) waren jetzt mit einer Neuauflage ihres damaligen Hits „Daylight in your Eyes“ beim Silbereisen und seinen „Schlagerchampions 2021„. Das erinnert mich irgendwie an Unheilig, von denen ich damals auch eine CD im Regal stehen hatte und für dessen Existenz der selbigen man vor ein paar Jahren Hausverbot im schwarzen Universum kassierte. Ich bin froh, der Absprung geschafft zu haben! Jetzt sitze ich hier, mache die Wochenschau fertig und rede mir ein, in Würde gealtert zu sein und frage mich trotzdem, wie es die 4 Idole der Generation „Arschgeweih“ es geschafft haben, 20 Jahre so spurlos weggewischt zu haben. Ich nehme die falsche Cremé. Bestimmt.
Necronomicon in Ägypten endeckt – Ancient „Book Of The Dead“ scroll found in egyptian tomb | WIRE (englisch)
Wer erinnert sich nicht an das Necronomicon, das legendäre Buch der Toten. das einst von H.P. Lovecraft erdacht wurde und mit dem Film „Tanz der Teufel“ ins popkulturelle Gedächtnis gebrannt wurde? Jetzt wurde so etwas ähnliches bei Ausgrabungen in Ägypten entdeckt: „Internationale Archäologen haben im 4.200 Jahre alten Grabtempel von Königin Nearit, einer Frau des Pharaos Teti, einen neuen Schatz entdeckt.[…] Neben der 13 Fuß langen Papyrusrolle „Buch der Toten“, die Wege zu den Unterwelten der Verstorbenen zeigt, enthält der Schatz auch über 50 hölzerne Sarkophage, ein Senet-Brettspiel, ein Flussboot mit Ruderern und eine Statue von Ptah-Sokar-Osiris , Holzmasken, ein Anubis-Schrein und ein Grabheiligtum, das einer Königin des Alten Königreichs gewidmet ist.“
Seatemples – Post Punk, Cold Wave und Shoegaze aus Chile | Mina Miau
Es gibt doch noch Blogs, die stets einen Besuch wert sind. Mina Miaus gleichnamiger Tempel der Worte, in dem auch Victor von Void gelegentlich ein Opfer bringt, ist so ein Ort der spirituellen und dennoch zutiefst weltlichen Einkehr. Unbedingt öfter Vorbeischauen! Sonst entgehen euch Perlen wie dieses Interview mit chilenischen Band „Seatemples“. „Seatemples beschreiben ihre Musik als vom Post Punk, Shoegaze und Dreampop inspiriert, mit “dark neo psychedelia” – Einflüssen und sicherlich auch jene des Cold Wave, wie beispielsweise im Song Chaosphere. Allerdings wollen sie in ihrer Musik auch ihre kulturellen Wurzeln betonen, sehr schön zu hören in Desierto. Allein bei diesen beiden Liedern erkennt man, dass Seatemples nicht auf ausschließlich eine Richtung festgelegt werden können.“
„Die Trommel brauchte ein Blutopfer“ – Aufstieg des Dark Nordic Folk | The Guardian (englisch)
Durch Herr der Ringe, Game of Thrones oder Vikings erlangte Dark Nordic Folk ein breiteres Publikum. Bands wie Wardruna, Myrkur oder Heilung werden populärer und nordische Mythologie, die bis dahin ein Nischendasein fristete, für vielen Menschen interessanter. Allerdings meinen es viele Bands ernster, als manchen Zuhörer lieb sein dürfte. „„Die Knochen bekommen viel Aufmerksamkeit“, sagt Juul (Heilung), „aber wir spielen auch mit menschlichem Blut herum. Unsere Trommel in der Mitte der Bühne heißt Blood, was „Blut“ bedeutet. Das ist mit dem Blut von uns dreien gemalt. “ […] „Wir haben eine gute Freundin, die Krankenschwester ist, und sie hat uns professionell beim Extrahieren geholfen“, fügt Franz hinzu. „Es gibt eine enorme Energie im Blut. Wir waren der Vorstellung fremd, als Kai kam und sagte, die Trommel brauche ein Blutopfer. Aber etwas zu malen und deine eigene DNA zu sehen, war eine sehr spirituelle Erfahrung.“
Was will der Undercut? Kritik an einer Trendfrisur | FAZ
Ulrich Holbein wirkt wie langhaariger und bärtiger Zausel, der zwischen 15.000 Büchern im hessischen Knüllwald wohnt. Und der will uns was über den Undercut erzählen? Ich fänd ja jetzt spannend, was er in diesem Artikel zu sagen hat. Allerdings verbirgt die FAZ seinen renommierten Autor hinter einer Paywall, die man zwar temporär mit einem Probeabo knacken kann, die dann aber 12€ im Monat und später mit 20€ im Monat endet. Einen einzelnen Artikel kaufen? Fehlanzeige. So bleibt seine möglicherweise spannende Ansicht der breiten Masse der Undercut-Träger verborgen, die aus Gefühl nicht zur FAZ-Abo-Klientel zählen dürften. Und so nutze ich Undercut und Holbein ohne „h“ für (m)eine Form der Kulturkritik. Und nein, ein weiteres Abo für eine Zeitung, in der mich 90% aller Artikel nicht interessieren, ist 2021 einfach nicht mehr zeitgemäß.
Siouxsie & The Banshees retteten Punk davor, zur Lachnummer zu werden und erfanden Goth | Louder (englisch)
Kris Needs von „Classic Rock“ muss ein ganz besonderer Siouxsie & The Banshees Fan sein, um so einen, fast schon liebevollen und eindrucksvollen Rückblick auf die Band rund um die britische Ausnahme-Künstlerin zu schreiben. „Für Susan Ballion aus Chislehurst markierte die Band den Höhepunkt ihrer Flucht aus der Vorstadtnormalität. […]“ Nicht nur für ihn ist klar, dass Siouxsie und The Banshees mehr Einfluss hatten, als sie damals ahnten. „Heute sind Siouxsies Bilder und Inhalten in vielen Sängerinnen zu sehen, die ihr nacheifern, aber ihren eigenen Weg gehen. Siouxsie And The Banshees retteten den Punk vor der Parodie, schufen überirdische Hit-Alben, erfanden Goth und lösten sich trotzdem mit einer seltener Würde auf. One of a kind, once upon a time.“
Anton Corbijn veröffentlicht günstige Version von Depeche Mode Fotobuch | depechemode.de
Zur Erinnerung: Letztes Jahr veröffentlichte Anton Corbijn, der Haus- und Hof-Fotograf von Depeche Mode einen Bildband. 512 Seiten, 500 Bilder aus 37 Jahren zwischen 1981-2018. Eindrucksvoll auch der Preis: 750€ (!!!) Hab auch damals nicht darüber berichtet. Ätsch! Hat trotzdem nichts daran geändert, dass die gesamte Auflage von 1.986 Stück blitzschnell ausverkauft war. Jetzt gibt es das Buch für 100€, natürlich etwas kleiner und auch ohne die Autogramme der Stars. Bestellen geht schon, geliefert wird ab Mai. Luxusprobleme echter Devotees.
Queering Horror – zwischen Gruft und Glamour | Pink Life
In Berlin sind queere Künstler mangels Bühne jetzt ins Netz ausgewichen. Mit PINK.LIFE hat man im Internet einen leuchtenden Regenbogen-Banner gehisst und legt auch gleich gut los mit „Queering Horror“. Schaut ihr mal vorbei: „Theatralisch und schaurig-schön inszeniert sich Drag Queen Christina Corpse in ihren Videos. Die Kreatur, die sie vor der Kamera beschwört, pendelt irgendwo zwischen Frankensteins Braut und der düsteren Eleganz einer Morticia Addams. Das ist kein Zufall, denn schon seit ihrer Kindheit ist die kultige Filmfigur aus der „Addams Family“ Christinas Vorbild. Mit flackernden Schwarz-Weiß-Aufnahmen, dramatischen Gesten und skurillen Vintage-Spritzen, zitiert die Video-Künstlerin Elemente aus klassischem Gothic Horror.“
Vulkan-Ausbruch auf Island: Nah dran ist nicht nah genug | Youtube
Der auf Island ausgebrochene Vulkan mutiert zur waschechten Touristenattraktion. Früher sind die Menschen noch panisch weggelaufen, heute sind Vulkane weniger gefährlich.
Goth Fitness | Adult Swim
So Zeit, den aufgeblähten Leib wieder in Form zu bringen. Endlich gibt es auch eine anständige, wenn auch Englischsprachige, Anleitung, wie man sie wieder Fit macht.