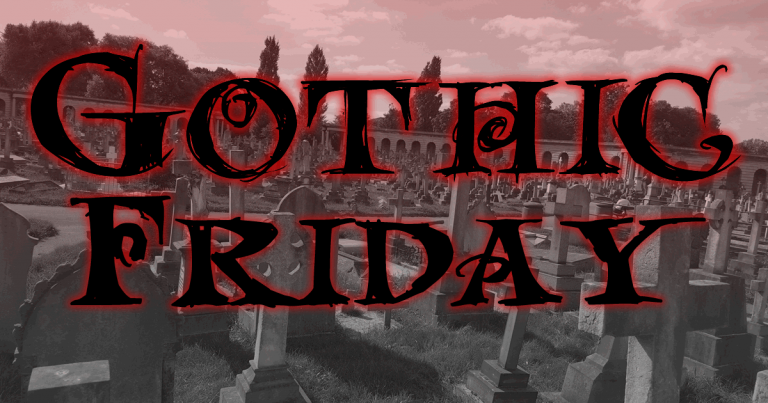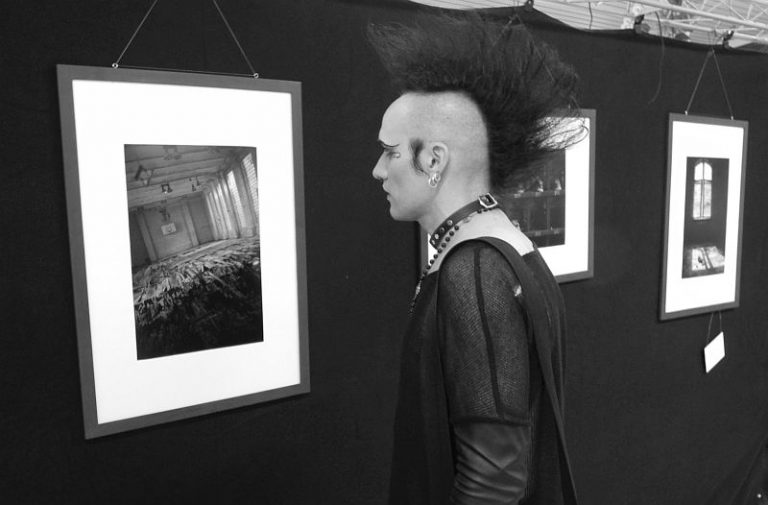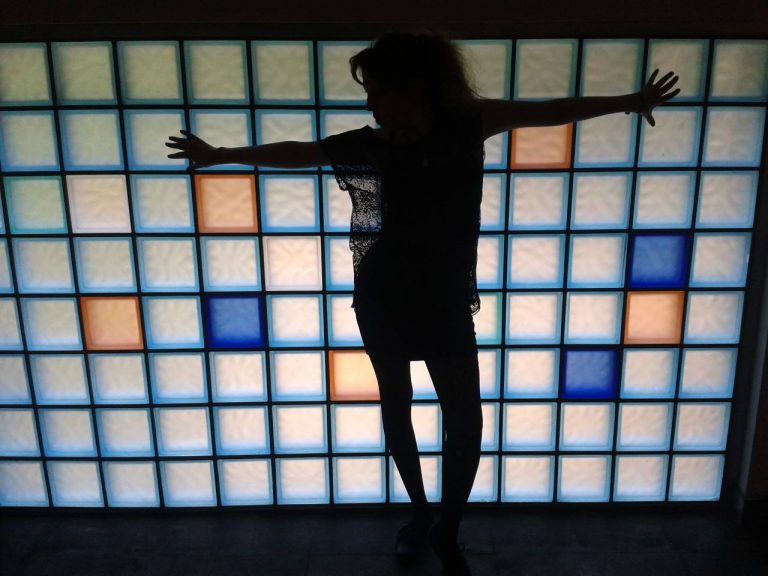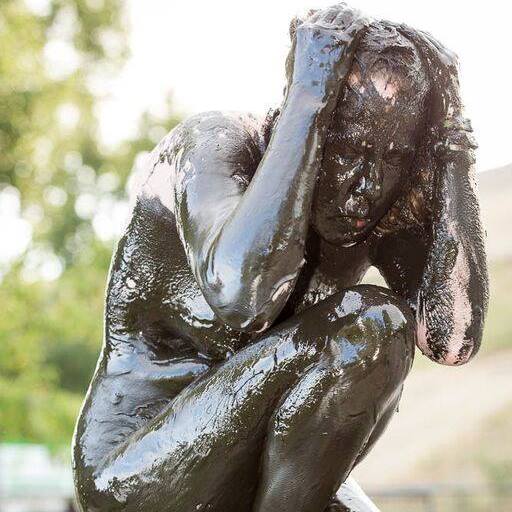Der letzte Freitag des Monats ist das gleichzeitige Ende des Monats-Themas für den Gothic Fridays 2016, bei dem wir im aktuellen Februar danach gefragt hatten, wie ihr in die Szene gekommen seid oder warum ihr euch immer noch zugehörig fühlt. Meine Skepsis, ob ein erneutes Projekt wie dieses immer noch auf begeisterte Leser stoßen würde, war unberechtigt. Ich bin schlichtweg begeistert von der Fülle und der Qualität der Beiträge, die rund 30 Teilnehmer im Februar niedergeschrieben haben. Was mich besonders freut ist die Mischung aus treuen und völlig neuen Lesern, die sich bereit erklärt haben, ein bisschen von dem Preiszugeben, was sie nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich ausmacht.
Zusammen mit Svartur Nott vom Gothic-Friday-Team, der den größten Teil dieses Artikels geschrieben hat, möchte wir versuchen auf den Punkt zu bringen, was Menschen in die Szene bringt oder sie darin hält. Bringt ein bisschen Zeit mit, es gibt viel zu lesen.
Wie seid ihr in die Szene gekommen?
Während 2011 der Einstieg der Teilnehmer noch sehr von Musik geprägt war, zeichnet sich dieses Jahr bereits ein differenzierteres Bild ab, denn das Internet eine wichtige Informationsquelle für die Neugierigen geworden und gleichzeitig ein virtueller Treffpunkt Gleichgesinnter. Vorbei sind die Zeiten, in denen die Bravo als Wegweisendes Instrument für unzählige Szene-Einstiege verantwortlich war. Jedenfalls bei den jüngeren Teilnehmern. Cookie war die erste neue Teilnehmerin, die in ihrem Blog gleich auf dieses Phänomen eingeht und schreibt: „Das Schlüsseljahr war sicher das Jahr 2000, denn da bekamen wir Zuhause Internet-Zugang und auf einmal konnte man sich zu allem informieren, was man wissen wollte und Kontakte zu Leuten aufbauen, die genau so tickten, wie man selber.“

Aber auch andere Medien hatten einen Anteil daran, dass Menschen, deren Interessen sich mit der Szene überschnitten, ihr zuwandten. So bekam Wiener Blut „anfang der 2000er (…) medial den ersten Kontakt mit der Szene, real dann über meine jetzige Frau, die ich dann in dem Zeitraum kennengelernt habe, und die schon einige Jahre unterwegs war.“
Beatrice de Son Bages wurde einen Onlinekontakt in einem Sterbehilfeforum auf Taria Turunen aufmerksam gemacht, welchem ein Konzertbesuch und die fast alljährliche Teilnahme am WGT folgte.
Ebenfalls über das Internet und die Musik gelangte Dennis in den Bannkreis der Szene. Mit dem ersten Zugang zum Netz 1995 stolperte er über die Band „Deine Lakaien“, welche er jedoch damals mangels Soundkarte nicht hören konnte. Es dauerte ein paar Jahre, ehe ich wieder darauf stieß. Eine Freundin erzählte auf einem Drehleierfestival (dem berühmten in Lißberg), dass sie jetzt eigentlich weniger Folk und mehr Darkwave höre. Darkwas? Dieser Begriff war mir neu, und so lag einige Wochen später ein Mixtape im Briefkasten, mit den Lakaien (Acoustic), Qntal und Estampie. Die letzten beiden boten wunderbar neu interpretierten Folk, und die Lakaien in der Acoustic-Version passten wunderbar dazu. Ich war begeistert!
Bei Dagmar „Mottenprinzessin“ kelaino war das entscheidende Medium die Bravo, welche sie eines Tages auf einer Schulbank fand: “ Ich blätterte herum und fand einen Artikel über Gruftis — wahrscheinlich begleitend zu einer der Foto-Love-Stories. Als ich den Artikel durchgelesen hatte, hab ich zum ersten Mal gewusst, dass ich nicht alleine bin und auch andere so fühlen wie ich. Aus der Ferne betrachtet waren dort natürlich genug Klischees genannt worden, aber so genau hab ich das nicht genommen. Meine Klassenkameraden haben dann ziemlich über den Artikel gelästert, aber ich wusste insgeheim, wohin meine Reise gegen würde.“
Einstiegsdroge Musik – Die verlockenden Klänge der schwarze Szene
Die Musik bleibt jedoch die größte Gemeinsamkeit aller Einsteiger. Nähkäschtle Feli, die durch ein Album von HIM, dass sie in der elften Klasse hörte und darauf hin eine Freundin ansprach oder auch die Fledermama Janina, die im Kunstunterricht die Hälfte eines Kopfhörers bekam: „Ich steckte ihn mir ins Ohr und… An dieser Stelle müsst ihr euch das wie in einem Film vorstellen. Nahaufnahme des Kopfhörers, wie er mit demsilikonbenoppten Teil im Gehörgangversenkt wird – Nahaufnahme eines grün-blauen Auges – nichts als ein Herzschlag zu hören – derPuls erhöht sich – die Pupille weitet sich in Erstaunen. „Was’n das?“ „ASP“. „Und das?“ „69 Eyes.“ „Und das?“ „Lacrimosa.“. So ging es praktisch die gesamte Doppelstunde über.“
Bleikind gelangte über musikalische Umwege in die Szene. Nach einem Auslandsaufenthalt in Spanien begegnete man ihr in ihrer provinzlichen Heimat misstrauisch und ablehnend, sodass sie sich aufgrund deren „melancholischen, teils weltablehnenden Note“ Linkin Park zuwendete. Über ein Video im Netz wurde sie dann auf die Szene aufmerksam, schaute hörte sich durch Youtube-Videos, bis es bei „Bauhaus‘ – Bela Lugosi’s Dead“ Klick machte.

Fogger bekam 1987/88 von einem Freund ein Tape in die Hände gedrückt. Auf der A-Seite Depeche Mode, auf der B-Seite jedoch The Cure, von welchen er nun völlig überwältigt war: „Nichts hat mir vorher soviel gegeben, wie diese Musik. Ich glaube ich muss hier niemandem dieses Gefühl erklären. Ein Gefühl welches heute noch so aktiv ist, das ich mich zurückhalten muss, nicht auf jedes Konzert in Deutschland oder Europa zu fahren.“
Nagumo war ab Ende der 80er, anfang der 90er in einer heftigen Selbstfindungsphase und Sinnsuche, „probierte so gut wie jede Subkultur durch, die Westdeutschland bis dato zu bieten hatte“. In den Jahren gab es Bands wie Das Ich, The Cure, Depeche Mode, Silke Bischoff, welche ihn nicht losließen und immer wieder heimsuchten. Nach Loslösung von seiner damaligen Peergroup und Beginn eines Studiums, stieß er auf zwei weitere Bands: „Diesmal waren es Sopor Aeternus und Lacrimosa und diese waren dann auch die letzten Steine, die fehlten, um mich einer Subkultur zuzuwenden, der ich bis heute angehöre. Ich war fasziniert von dieser Melancholie. Ich war fasziniert von der Todesästhetik und ihrer unglaublichen Schönheit…. aber am meisten war es die Musik.“
Magister Tinte, Schreiber des letzten Beitrages, hatte diverse Zugänge zur Szene. Er konzentrierte sich in seinem Beitrag auf den Einstieg über die Musik durch das Medium Internet: „Mit ungefähr 18 Jahren stieß ich auf die Sisters of Mercy, eine Band die keiner meiner Freunde kannte, und erst recht nicht hörte. Nur mit dem Wissen das die Musik etwas älter war, als all das Andere was ich kannte, stieß ich nach einiger Zeit auch auf Joy Division und Depeche Mode. Nachdem ich langsam dahinter kam, wonach ich suchen musste, fand ich immer mehr passenderes und artverwandtes im Internet dazu. Ich fand auch Clubs in denen auf kleineren Floors Musik lief, die ich zwar nicht kannte aber die mir sofort gefiel.“
Selbst wenn sie sich selbst nicht mit der Szene identifizier(t)en, gab es dennoch Menschen, welche ebenfalls über die Musik in sie hineinrutschten oder zumindest in ihr Umfeld gerieten. +VLFBERH+T kam über „obskuren Black Metal“ in die Szene, um welche er „mal näher, mal ferner herumorbitiert„. Führ ihn ist die Musik nach wie vor das wichtigste Element und er schätzt „(…) die Fähigkeit der Szene, immer wieder Großartiges hervorzubringen.“
Vorbilder – Den andere die Schuld in die Schuhe schieben
Neben der Musik sind Freunde oder Klassenkameraden ebenfalls immer noch häufig Schuld daran, dass sich der ein- oder andere in der Szene verirrt. Asti freundete sich bereits in der Schule mit einer Klassenkameradin an, die offenbar ein Mitglied der Szene war: „Es war nicht nur ihr Stil sich zu kleiden, sondern auch ihre ganze Art und Weise, offen, freundlich, ehrlich, was zwar sehr im Kontrast zu ihrer äußeren Erscheinung stand. Mein Interesse war geweckt worden, denn wirklich zuhause fühlte ich mich in der „bunten“ Welt nicht.“
Ronny Rabe kam 1993 über einen Freund mit Lacrimosas Album „Einsamkeit“ in Kontakt: „Wir haben es zusammen gehört und ich war sofort hin und weg. Die Vertonung der Texte und die Aufmachung der Band, für mich eine Offenbarung – ich war fasziniert. Ich habe davor schon Gedichte und Gedanken für mich niedergeschrieben, welche ich eben in den Texten von Lacrimosa wiedergefunden habe. Mich faszinierte nicht nur die Musik sondern auch der Mensch Tilo Wolff und so begann ich alles zu sammeln und mein Äußeres zu verändern.“

Der Einstieg von Ursula geschah über ihre Interessen und der Abgrenzung gegenüber ihren damaligen Mitschülern , mit denen sie nicht viel anzufangen wusste – was auf Gegenseitigkeit beruhte. Und dann, „in der Oberstufe, als unser Jahrgang durch neue Mitschüler verstärkt wurde, traf ich auf einmal auf Leute, die die gleichen Vorlieben teilten, die gleichen Bücher lasen, die gleichen Filme guckten, die das Diktat der angesagten pastellfarbenen Markenklamotten ebenso gräßlich fanden wie ich und bei denen die Top Ten nur Brechreiz auslöste. (…) Von Gruftis und Wavern hatte ich bis dato auch schon vernommen – Bravo sei Dank! Irgendwie passte das zu mir.“
Miss Makaber wurde unter die Fittiche einer Klassenkameradin, die drei Stufen über ihr war, genommen: „Die junge Dame war aber natürlich weder blind noch blöd und merkte irgendwann, das ihr ein kleines, unsicheres Irgendwas im schwarzen Shirt, schwarzer Hose und schweren Deichmann Stiefeln (Springer waren zu dieser Zeit noch viel zu teuer für mich) hinterher huschte. Freundlich nahm sie mich zur Seite,sprach mich an und nahm mich dann unter ihre Fittiche.“
Flederflausch fand bereits zu Schulzeiten die Schwarzkittel, denen sie begegnete, faszinierend: „Ganz in schwarz – lange, wehende Mäntel, schwere Schuhe – erhabend gleitend durch die bunten Massen der betongrauen Schulgänge und bunten Halbstarkenmassen. Unzählige Pause verbrachte ich damit sie zu beobachten (…).“ Ursprünglich nichts mit der Musik am Hut hatte, sollte sich das daraufhin ändern, als ihr ein Freund „sein unerschöpfliches Sammelsurium an Musik aus dem Bereich Metal, Gothic Rock und was es alles war eröffnete. (…) In der Musik fand ich Gedanken, Gefühle und Situationen ausgedrückt, die ich selbst nicht in Worte fassen konnte. Dort fand ich mich verstanden.“
1980 veröffentlichten Visage mit dem extrovertierten Sänger Steve Strange ihre erste LP. Es dauerte nicht lange, und GM wurde auf ihn aufmerksam: „Seine ausgefallene Kleidung gefiel mir. Ich probierte meinen Kleiderstil etwas nach ihm auszurichten und sparte auf meine allererste LP, die ich irgendwann kaufen konnte.“ An einem Abend im Ballhaus Tiergarten traf sie auf einen jungen Mann, der „komplett schwarz gekleidet (war) und schwarze Haare (hatte), die an den Seiten kurz geschnitten waren und deren langer Pony zur linken Seite fiel.“ Durch ihn lernte sie die für sie erste schwarze Musik kennen, Joy Division und Bauhaus.
Bibi Blue wuchs bis Anfang der 80er erst im Ost-Berlin und danach im Skopje des damaligen Yugoslawiens auf. Dort wurde sie durch Klassenkameraden in die dortige, äußerst heterogene Punk-Szene gezogen, welche einige stille, melancholische Wesen beinhaltete. Es wurde viel erlebt, diskutiert, Musik ausgetauscht und die latente Ahnung des kommenden Krieges, die omnipräsente Untergangsstimmung wirkte als Verstärker aller Leidenschaften. Eigens geschwärzte Kleidung wurde von Bibi „als Abbild meiner seelischen Fetzen getragen„. Sie fühlte sich „(…) fremd in der Welt, doch in der Szene zu Hause (…), im Wunderland“
Traumtänzerin hatte mit 16 die erste scheue Begegnung mit Gruftis: „Ich sah sie nur aus der Ferne und war trotzdem schon fasziniert. Ich beschloss: so jemanden musste ich einfach kennenlernen.“ Über eine Freundin wurde sie in die moderne Mittelalter- und Gothicszene eingeführt, welche ihr jedoch nicht lange zusagte: „Ich merkte schnell, dass sich auch dort oftmals einfach die üblichen Trottel herumtrieben.“ Auf der Suche nach mehr Tiefe, landete sie bei Spontis: „Es kam wie es kommen musste: ich verschlang einen Artikel nach dem anderen der auf Spontis und anderen Blogs in dessen Dunstkreis gepostet wurden.“ Dort stellte recht schnell fest: “oh ich bin ja wie die” und fühlte sich wie zu Hause angekommen.
Der schleichende Prozess
Bei manchen war es ein eher stufenweises Hineingleiten, so auch bei Marion Levi. Erste Eindrücke, sowohl aus ihrem Umfeld, als auch im Alltag, sowie eigene Nachforschungen und neuentdeckte Musik vertieften nach und nach das Interesse, auch wenn sie es „mehr (als) ein Herumlungern am Rande, ein Hineinschnuppern und Beobachten“ beschreibt. Letztlich, so sagt sie, ist sie „quasi unbeabsichtigt nach und nach immer tiefer in die Szene hineingerutscht und dort geblieben, einfach weil es irgendwie zu passen scheint“ und „das Gruftie Sein ganz selbstverständlich zu mir und meinem Alltag gehört.“
Auch beim Gruftfrosch war es ein schleichender Prozess, an dem die Musik einen nicht unerheblichen Anteil hatte. Bereits als Kind… „(…) mochte ich lieber Lieder, die melancholisch daherkamen. Ich liebte diese Lieder, auch wenn ich die Texte damals nicht verstand.“ Seine Interessen für Malerei, Photographie, Architektur und Historie begünstigten den sachten Einstieg, bei dem „mit der Zeit ganz allmählich das Bunte aus dem Kleiderschrank wich“. (…) Das Lesen in der Gedankenwelt der anderen schwarzen Seelen war (…) neben Musik, Gefühl und Ästhetik das, was mich in seinen Bann zog. Neben viel Oberflächlichkeit, die man ja auch aus der bunten Welt zur Genüge kennt, eben auch die anderen zu treffen und mit ihnen zu reden, zu schreiben, an ihrem Wissen, ihren Gedanken teil zu haben, mit ihnen zu diskutieren.
Warum seid ihr immer noch in der Szene?
Stoffel war die erste vom Club der Ursprünglichen (die schon beim Gothic Friday 2011 mitgemacht haben), die sich der Frage, warum sie immer noch in der Szene seien, gestellt hat. Überhaupt war sie die Erste, die überhaupt etwas eingereicht hat. Für sie gibt es nur eine Erklärung für ihre mittlerweile langjährige Szene-Zugehörigkeit: „Zusammenfassend kann ich sagen das ich mich der Szene immer noch zugehörig fühle durch Freunde, Musik (Selbige ist essentiell für mich), persönliche Einstellung und weil ich mich in der Szene einfach wohlfühle.“

Der Prinzessin geht es da ganz ähnlich, war sie doch in den letzten zwei Jahren hauptsächlich für ihren Nachwuchs da: „Seit über zwei Jahren steckte ich nicht mehr in Korsett und Reifrock – es fehlt mir so sehr. Das ist eigentlich ein Zeichen für mich, dass die Gothic-Szene immer noch mein Zuhause ist.“
Tanzfledermaus, welche bereits im November und Dezember des letzten Jahres ausführlich ihren Einstieg in die Schwarze Szene dargelegt hatte, sieht diese heute etwas zwiespältig und fühlt sich einerseits nicht mehr ganz so heimisch. Auf der anderen Seite jedoch ist sie glücklich über „(…) die Nischen, in denen ich mich bewegen kann“, denn eine echte Alternative, welche sich mit ihren Interessen, Lebensstil und Lebensgefühl überschneidet, gibt es nicht.
Die Szene als Rückzugsraum, als kleine, für Außenstehende unsichtbare Welt, wird auch von ElisaDay „nach all den Jahren (…)“ als „eine Nische, in der sie sich ausleben und wohlfühlen kann“ genutzt. Die Art, in der Szene zu leben und das Leben zu gestalten, genießt sie und findet es schön, bemerkt dabei aber auch, dass es wichtig ist, „dass man den ganzen Kram nicht zu ernst zu nimmt“.
Sabrina sieht es aufgrund ihrer Interessen und Ansichten als völlig natürlich an, dass sie sich weiterhin in der Szene aufhält, da für sie der Szene mit ihrem Leben verschmelzen: „Heute halte ich mich also noch immer an Orten auf, deren Ambiente ich mag. Ich kleide und schminke mich so, wie ich es schön finde. Ich treffe mich mit Leuten, die ich mag und ich gehe zu Konzerten und Festivals, bei denen meine Musik gespielt wird. Ich suche mir kulturelle Veranstaltungen heraus, die mich interessieren und ich unternehme Dinge mit Freunden, die mir Spaß machen. Das kann man nun natürlich „Szene“ nennen. Ich nenne es „mein Leben.“
Auch Shan Dark sieht es ganz gelassen und meint: „Solange es mir also in der schwarzen Szene gefällt, bewege ich mich in ihr, denn sie bietet mir einen erweiterten Zugang zu mehr Menschen und Veranstaltungen. Mehr Auswahl und Möglichkeiten.. Menschen, mit denen ich die selben Interessen, Stimmungen, Gefühle und Geschmack teilen kann. Und natürlich Amüsement nach meinem Geschmack – Partys, Konzerte, Festivals, Filmvorführungen, Gespräche, Friedhofsbesuche, Ausflüge und „blaue Stunden“. Das alles bietet mir „meine Szene“: initiales Kennenlernen, (un)regelmäßiges Wiedersehen, gemeinsames Schwelgen in geistigen und realen Räumen.“
Nadja Karpenko sieht sich in einer distanzierteren Position zur Szene als noch vor 5 Jahren. Sie hatte immer mehr das Gefühl, „dass mir Gothic nichts mehr Neues und Aufregendes bieten kann (…) und nun die Frage kommt: Was jetzt?“ Mit der Zeit fragte sie sich: „Brauche ich also wirklich eine Szene, die mich vollständig repräsentieren kann?“ und fand für sich die Antwort: „Ich persönlich möchte mich nicht auf eine Schublade beschränken, am liebsten möchte ich in gar keiner sein. Ich setzte mir doch selbst keine Grenzen.“
Auch für Guldhan ist die Szene längst kein Platz mehr, an dem er sich zu Hause fühlt und dennoch irgendwie zu Hause ist, denn offensichtlich sind wir die einzigen Reihen, in denen Underdogs noch ihr Wunden lecken können: „Ja, ich sehe mich noch als Underdog. Und deshalb schleiche ich noch durch diese Reihen. (…) Bin der Köter, der sich hier verkrochen hat, der im Dunkeln seine Wunden leckt und sich nur noch zum fressen und scheißen raustraut. Von mir aus kann man mich auch als einen derjenigen Gebrochen bezeichnen. Würde das nicht einmal leugnen. Und deshalb inhaliere ich die Musik. Lebe die Musik. Lebe einzig noch während der Musik. Stille ist Schweigen ist Selbstanklage. Und könnte sogar die Streitfrage losbrechen, ob die Szene jene Musik überhaupt verdiente.“
Für Robert, seines Zeichens Wiedergänger einer immer wieder totgeglaubten Szene und Inititator dieses Blogs, ist „das Gefühl, für Gruftis zu schreiben zu dürfen, die genau so ticken wie ich selbst“, eines der Gründe, warum er immer noch in der Szene ist.“ Dies und „die Leidenschaft für das morbide, abseitige, okkulte und mystische, die Ästhetik eines flackernden Grablichtes auf dem Grab eines Verstorbenen, die Stimmung des Nebels, der den Boden bedeckt aus dem nur die Blattlosen Gerippe der Bäume ragen,“ dies alles mit Gleichgesinnten teilen zu können, hält ihn in der Szene.
Was Aristides Seele immer in der Szene gehalten hat, „war – natürlich neben der Musik – die Leute. Selbst wenn es immer wieder bunte Ausnahmen gab, (…) so ist die Wahrscheinlichkeit, in der Szene auf Leute zu treffen, bei denen die Wellenlänge im Weitesten die Gleiche ist, einfach doch um einiges höher. (…) Bei meinem ersten, richtigen Schwarzclub-Besuch gab es dieses überwältigende Gefühl des “Daheim-angekommen-seins”, und dieses Zuhause wurde im Laufe der Jahre dann auch mit immer mehr Leuten angefüllt, die man sehr wohl als die eigene schwarze Familie bezeichnen kann und mit denen man nicht selten sehr tiefe und tolle Freundschaften entwickelt hat.“
Mit einem reflektierenden Ansatz schrieb zu guter Letzt ColdAsLife einen nachdenklichen Beitrag und schloss mit folgender Ansicht: „Ich benutze die Szene. Ganz egoistisch. Um mich zu sättigen. Um mir Selbstvertrauen zu geben. Um Schwermut und Verzagtheit zu highlighten. Um mich zu etikettieren, zu elitarisieren. Um besonderer zu sein. Um den ausgestreckten Mittelfinger zu verlängern. Um zu fühlen. Um zu spüren. Um etwas zu haben, ginge alles verloren. Um einen Panic-Room zu haben. Wenn auch nur um des Habens willen. Um ein Netz zu haben zwischen etwas. Was über dem Netz und unter ihm ist, weiß ich nicht. Aufgefangen werden wollen. Vielleicht bin ich so in die Szene gekommen.“ Und vielleicht auch deshalb geblieben.
Der Punkt
Erstaunlich. Nach über 30 Jahren Szene gibt es immer noch Menschen, die aus vielfältigen Gründen in die Szene „rutschen“. Sei es durch Freunde oder Klassenkameraden oder durch das Internet und andere Medien. Die Möglichkeiten, sich über die Szene zu informieren, sind schier endlos und auf Abruf verfügbar. Man kann also sorgfältig recherchieren, bevor man sich „Gothic“ fühlt und in Erfahrung bringen, was die Szene ausmacht. Das hat die Szene nicht nur immer größer gemacht, sondern auch immer noch aktuell für junge Menschen auf der Suche nach der Nische, in der sie einfach sie selbst sein können. Die Musik nimmt dabei den wichtigsten Bestandteil der Identifikation ein und ist für die Meisten, die sie zum ersten mal hören, eine Offenbarung. Die Musik der Szene trifft sie auf einer sehr emotionalen Ebene und drückt für viele aus, was sie denken und fühlen. Und das ist eben manchmal düster und abseitig, melancholisch und traurig oder auch bizarr und leidenschaftlich.
All das schafft ein Umfeld und einen Freundeskreis in dem man sich nicht verbiegen, anpassen oder zurückhalten muss. Menschen, die so denken wie du, die eine ähnliche Weltanschauung und auch die gleichen Interessen haben machen es einfach, seine kleine schwarze Welt zum Naherholungsgebiet zu erklären. Es ist auch für die Meisten ein Grund, sich weiter zugehörig zu fühlen, auch nach 10, 20 oder sogar 30 Jahren in „Schwarz“. Man tauscht ein paar Dinge, die die Szene ausmachen. War man früher rebellischer, intoleranter und wählerischer, wird man mit zunehmender Szenezugehörigkeit doch ein wenig resistent gegen die ständig neuen Einflüsse, die mal mehr und mal weniger in der Szene Einzug erhalten. Man tauscht nervenaufreibende Rebellion und kräftezehrendes Auswählen gegen eine gewisse Coolness, gegen die Einflüsse von Außen und gegen die Einflüsse des Alltags. Wenn man so möchte, hat die Suche von damals ein Ende und das, was man gefunden hat, erfüllt einen mit Zufriedenheit. Keine weiteren Wechsel notwendig, kein anpassen, kein erklären. Ein wenig müssen wir jedoch alle darauf achten, dass uns die Substanz der Szene nicht wegbricht und wir Coolness mit Ignoranz verwechseln.