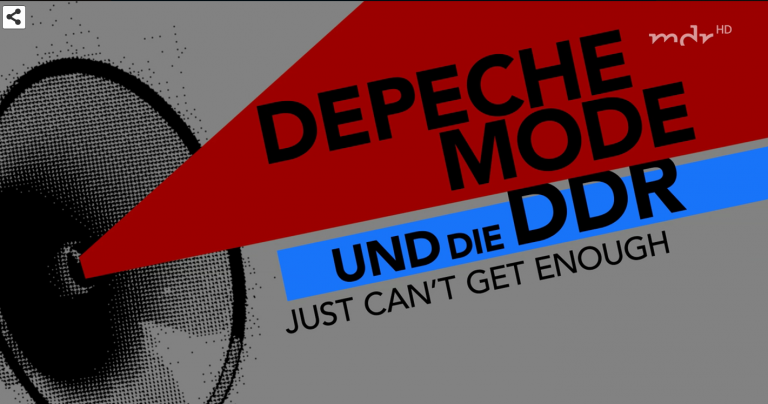New Wave. Der englische Begriff einer Musikform, die Ende der 70er Jahre den Plattenmarkt überflutete, klingt im Gegensatz zum deutschen Pendant „Neue deutsche Welle“ viel erhabener und edler. Schuld ist aber nicht die Begrifflichkeit, sondern eher die Tatsache, dass die eingedeutschte Welle, die von der englischen Insel an unserer Küste brandete, ziemlich schnell kommerzialisiert wurde und als Schlager mit elektronischen Beats vermarktet wurde und somit die wahren Perlen dieser Musikkultur im Untergrund versenkte. Heute wühlen wir jedoch in der „richtigen“ deutschen Welle. Stücke mit Geschichte und Geschichten, die längst hätten erzählt werden sollen.
Die neue deutsche Welle war eine großartige Musikrichtung. Niemand war sich zu schade, Musik mit allen Möglichkeiten zu machen, die sich damals boten. Deutsche Texte erlebten eine nie dagewesene Präsenz, die Abseits von Schlager und Volksmusik zu manchmal bizarren und zu manchmal großartigen Stilblüten führten. Zusammen mit dem Model Elke Steinberg gründeten Nick Mono und Clemens Fobianke die Band Monopol 1982 in Hannover. Die damalige Promoinfo zur Veröffentlichung ihres Albums war wohl ebenso verschwurbelt wie die Band selbst: „Nick Mono, Ostagent hat den Auftrag, einen Computerspezialisten einer westlichen Firma zu bespitzeln. Sein Name Cle. Es geht um das Geheimnis der neuen Computer-Musik, die Entspannung in der vierten Dimension. bei dem Entführungsversuch des Computerspezialisten durch Nick, stößt eine Blondine zu ihnen. Völliger Zusammenbruch der Aktion. Die Dame sucht Schutz vor Verfolgern aus der Unter/Oberwelt. Nick und Cle helfen bei der Flucht. Man kommt sich näher. Musik ist die Geheimformel! Das Aussteigen beginnt! Blondine läßt Jet-Set Jet-Set sein! Agent beantragt Asyl im Westen! Hochbezahlter Computerfachmann läßt Karriere sausen!“
Gleitzeit – Ich komme aus der DDR
„Atomarer Holocaust über Hamburg. Heller als tausend Sonnen detoniert eine H-Bombe von einer Megatonne. Die Bilanz: 900.000 Tote in einer Sekunde, ebenso viele Verletzte. Wer überlebt hat, beneidet die Toten. Die wenigen, die sich in Atombunkern retten konnten, leben weiter in einer apokalyptischen Todes-Wüste. Vision oder Wirklichkeit? TV-Journalist Tom Broken erhält vom Verteidigungsministerium den Auftrag, einen Film über ‚richtiges Verhalten bei nuklearen Kampfhandlungen‘ zu drehen, und gerät in ein alptraumhaftes Horror-Szenarium, das auf Knopfdruck sofort Wirklichkeit sein kann.“ Diese nun wirklich unbekannte Perle der deutschen Filmkunst erreicht nie ein großes Publikum, als er 1982 erscheint. Und dennoch ist auch er voll mit Zeitgeist, so pur und so intensiv, dass die Darsteller mitunter wie Karrikaturen einer Zeit wirken, die eben diese Ängste schürte. Darin auch eine Discoszene mit dem legendären Stück „Ich komme aus der DDR“ von Gleitzeit. Toll!
Drahtkur – Die letzten Tage
Es gibt immer wieder Stücke, die geistern bis zur Unkenntlichkeit getarnt auf Kassetten aus den 80ern. Bands, die es nie über einige Versuche, Musik zu machen, hinaus geschafft haben. Und dennoch gibt es Forscher und Entdecker, die diese Sache ausgraben und als Cover in die heutige Zeit tragen. So wie Zwarte Poezie, die sich ebenfalls als Musikperlentaucher betätigten und das Stück in die Neuzeit transformierten. Interessant ist Tatsache, dass der im Original schwer verständliche Text von rund 6 Jahren vom damaligen Bassisten der Band Dieter Geiß unter das Youtube-Video gesetzt wurde, den dann Edwin van der Welde zum Anlass nahm, ihn ins Niederländische zu übersetzen. Das Netz schreibt eben seine eigenen Geschichten: „Jeder fühlt es, das kann ich nur sagen; Es beherrscht ihre Sinne und die Zeit die sie haben; Ich fühl nichts, bin ich nicht mehr normal; Bin ich lebendig begraben? – Keine Panik, das kann ich nur sagen; Dass die Angst sich verselbstständigt kann ich nicht ertragen; Doch nach jedem Rasieren hab‘ ich Blut auf dem Kragen; Ja es war nie so schlimm wie in den letzten Tagen.“





 Erstmals starte ich den Versuch, das Spontis-Magazin über Crowdfunding finanzieren zu lassen. Helft mir und anderen, dieses seltene Stück Zeitgeschichte in den Händen zu halten. Mit einem Projekt bei Kickstarter möchte ich versuchen, die Druckkosten für das ca. 20-seitige Magazin und die Buttons wieder reinzuholen, die ich bislang aus eigener Tasche vorstrecke. So eröffne ich das Magazin und die Idee einer Gemeinschaft mehr Lesern und Gruftis, die in den Genuss kommen wollen einen gedruckte „Jahresrückblick“ in den Händen zu halten. Orphi und Sabrina Handt, sind schon fleißig dabei die Inhalte zusammenzustellen und das Layout zu designen, es lohnt sich also, mitzumachen.
Erstmals starte ich den Versuch, das Spontis-Magazin über Crowdfunding finanzieren zu lassen. Helft mir und anderen, dieses seltene Stück Zeitgeschichte in den Händen zu halten. Mit einem Projekt bei Kickstarter möchte ich versuchen, die Druckkosten für das ca. 20-seitige Magazin und die Buttons wieder reinzuholen, die ich bislang aus eigener Tasche vorstrecke. So eröffne ich das Magazin und die Idee einer Gemeinschaft mehr Lesern und Gruftis, die in den Genuss kommen wollen einen gedruckte „Jahresrückblick“ in den Händen zu halten. Orphi und Sabrina Handt, sind schon fleißig dabei die Inhalte zusammenzustellen und das Layout zu designen, es lohnt sich also, mitzumachen.