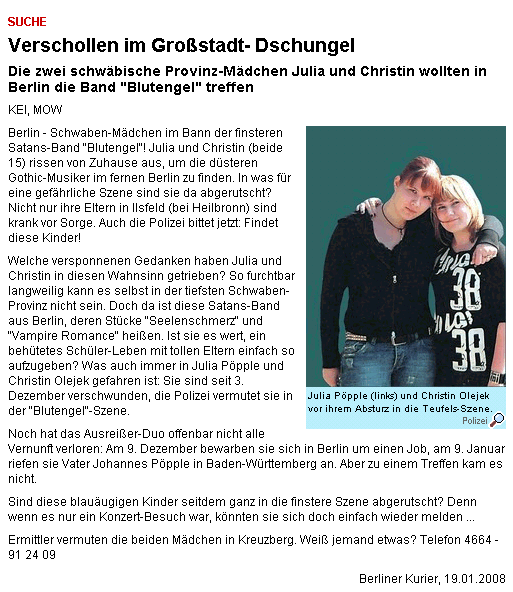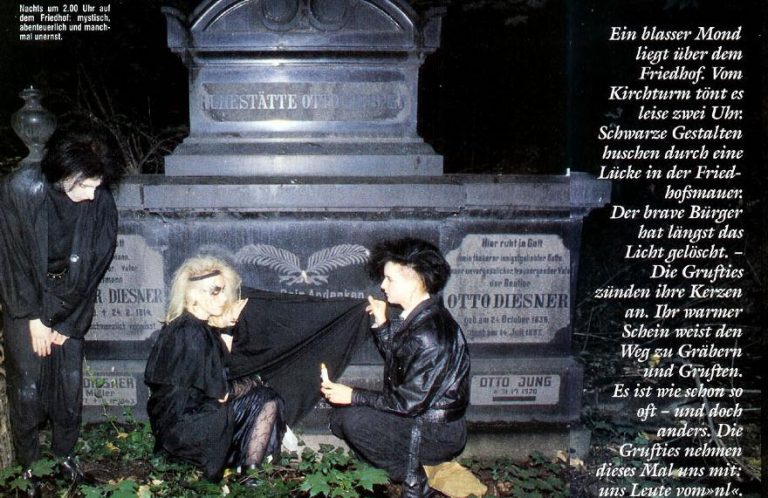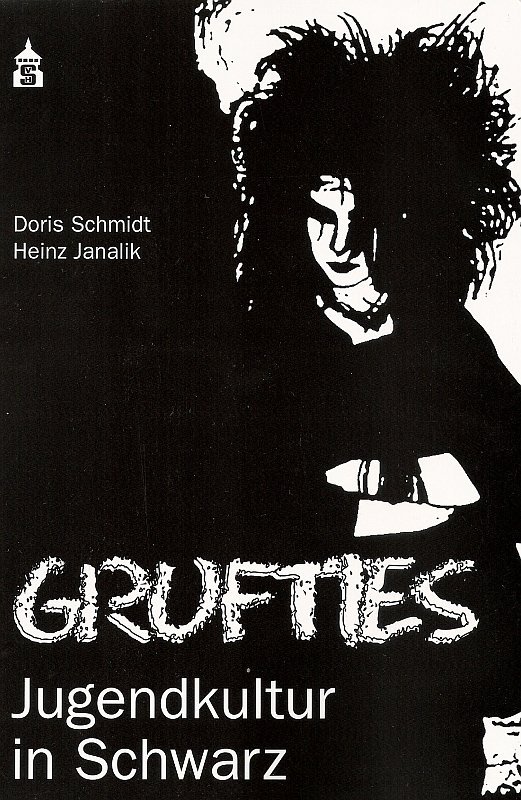Und es gibt sie doch! Eine Zeit lang war ich der Meinung, das die Zeitungen bei ihrer Berichterstattung über die Gothic-Szene dem allgemeinen Gusto der Akzeptanz gefolgt wären. So manch ein Autor lässt sich zwar zu Verniedlichungen oder auch humoristischen Einlagen treiben, verbale Mutationen die an die frühen Zeiten des Unverständnisses erinnern, sind aber weitestgehend verschwunden. In einigen Redaktionen gibt es sogar Engagement, die Jugendlichen und ihre Leidenschaften zu verstehen um sich dann halbwegs informativ damit auseinanderzusetzen. Das glaubte ich jedenfalls, bis ich über einen Artikel vom 19.01.2008 im Berliner Kurier stolperte. „Verschollen im Großstadt-Dschungel“ ist zunächst einmal der ernst gemeinte Hilferuf nach 2 Ausreißern, die aus der schwäbischen Provinz nach Berlin auszogen, um die Band Blutengel zu treffen.
Was Autorin Claudia Keikus dann daraus zaubert, erzeugt meiner Meinung nach Betroffenheit und Unverständnis und ist an Polemik, Verzerrung und Phantasie nicht zu überbieten. Im Text heißt es: „Schwaben-Mädchen im Bann der finsteren Satans-Band „Blutengel“! Julia und Christin (beide 15) rissen von Zuhause aus, um die düsteren Gothic-Musiker im fernen Berlin zu finden. In was für eine gefährliche Szene sind sie da abgerutscht?“ Wir fassen zusammen: Blutengel ist eine finstere Satans-Band und die Gothic-Szene ist gefährlich. Es würde mich ernsthaft interessieren, wie man darauf kommen kann. Was ist eine Satans-Band? Und natürlich ist die Gothic-Szene nicht gefährlich, sondern im Gegenteil für ihre Abneigung gegen Gewalt bekannt.
Weiter heißt es: „Welche versponnenen Gedanken haben Julia und Christin in diesen Wahnsinn getrieben? So furchtbar langweilig kann es selbst in der tiefsten Schwaben-Provinz nicht sein. Doch da ist diese Satans-Band aus Berlin, deren Stücke „Seelenschmerz“ und „Vampire Romance“ heißen. Ist sie es wert, ein behütetes Schüler-Leben mit tollen Eltern einfach so aufzugeben?“ Schon Wolfgang Petry sang einmal: „Das ist Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle?“ – Dunkler Satans-Kult und die Aufforderung den „rechten Pfad“ zu verlassen? Herrlich, ich beginne mich zu amüsieren doch der Hintergrund dieser Nachricht macht mir einen Strich durch die Rechnung.
„Sind diese blauäugigen Kinder seitdem ganz in die finstere Szene abgerutscht? Denn wenn es nur ein Konzert-Besuch war, könnten sie sich doch einfach wieder melden …“ Wäre es nicht einfacher gewesen die „finstere Szene“ um Hilfe zu bitten, seine Kinder zu finden? Offenbar scheint der Weg, die Szene als das ultimativ Böse darzustellen einfacher um den Blick der Öffentlichkeit auf das Schicksal der beiden Mädchen zu lenken.
Die ursprüngliche Meldung der Polizei, wie auf hierberlin.de zu finden ist, lautet übrigens ein wenig anders:
2 Tage später greift auf die Bild-Zeitung das Thema auf, entspannt die verbale Mutation leicht, feuert aber erneut auf die „Satans-Band Blutengel“. Vermutlich wollte beide gegen den Willen ihrer Eltern die Band besuchen und sind deshalb nach Berlin ausgebüchst. Hoffentlich sind beide wieder wohlbehalten in der schwäbischen Provinz angekommen und konnten ihr behütetes Schüler-Leben weiterführen.