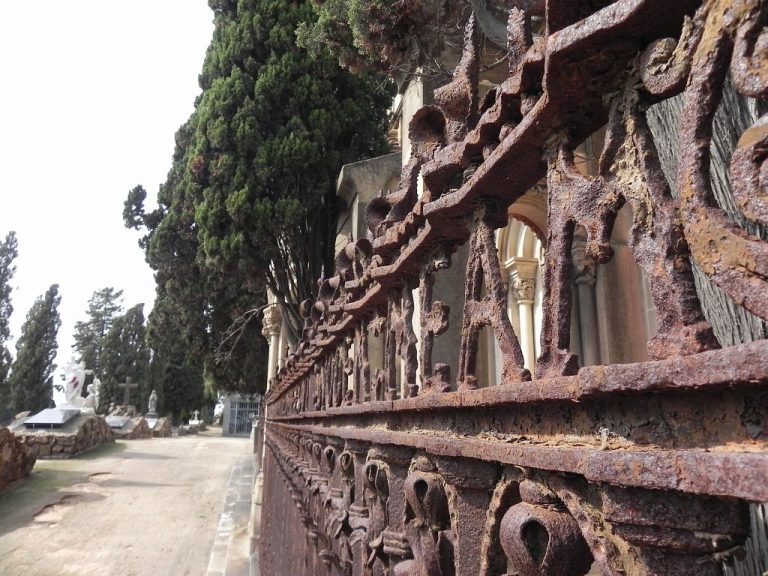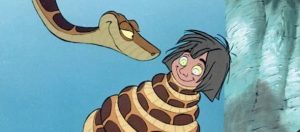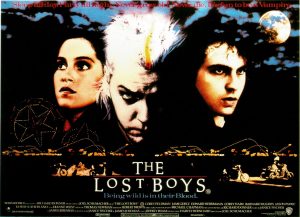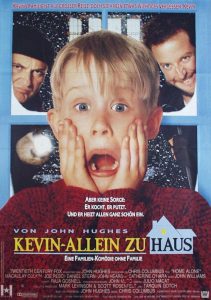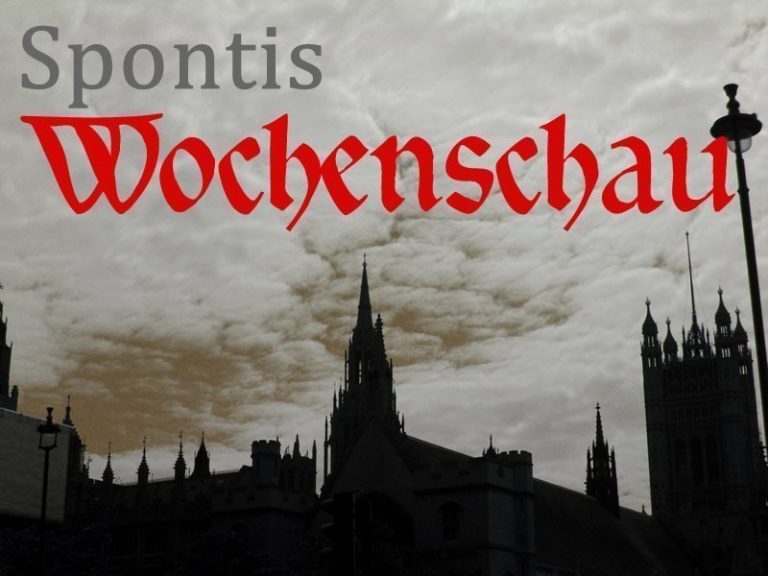Bei der Premiere des Amphi-Festivals in der Kölner Lanxess Arena ging es stürmisch zu. Sturmtief „Zelijko“ sorgte am Samstag dafür, dass die Außenbereiche geschlossen blieben, der Ablaufplan durcheinandergewirbelt wurde und etliche Bands ersatzlos ausgefallen sind. Immerhin profitierte das Festival bereits vom Umzug in die große Arena, denn am Tanzbrunnen hätte es wohl noch eingeschränkter stattfinden müssen, wenn es nicht sogar abgesagt worden wäre. Einige andere Festivals in der Region hatten weniger Glück: Das Juicy-Beats Festival im Dortmunder Westfalenpark wurde abgesagt. Tausende Fans warten nun auf eine Rückerstattung. Am Sonntag konnte das Amphi dann aufdrehen, die Außenbereiche wurden wieder geöffnet und auch das Wetter zeigte sich von seiner freundlicheren Seite. Doch wie war die Atmosphäre auf dem Amphi? Konnte der Veranstalter den Erwartungen der Gäste gerecht werden? Eignet sich die Lanxess-Arena überhaupt für solch schwarze Musikspektakel? In den sozialen Kanälen gehen die Meinungen weit auseinander und auch die Presse spiegelt dieses Bild wieder. Im Kölner Stadtanzeiger wird Besucherin Dagmar zitiert: „Ihre Stimmung hielt sich in Grenzen: „Eine Atmosphäre zwischen Flughafenhalle und Eishockey. Das passt überhaupt nicht zur Szene“, sagt die 35-Jährige. Sie trauert dem Tanzbrunnen nach.“
Da ich selber nicht dabei war, habe ich bei Facebook einen Aufruf gestartet, mir Erfahrungsberichte zuzuschicken. Auf ganz großartige Weise machte das Leser Mourant, dessen Eindrücke ich Euch einfach nicht vorenthalten kann. Es würde mich freuen, wenn auch ihr eure Eindrücke und Gedanken zur neuen Location des Amphi-Festivals loswerden würdet.
Mourant und der letzte Kreis der Hölle
Ich war bisher zweimal beim Amphi, 2012 und dieses Jahr. Schon beim ersten Mal hatte ich mir eigentlich geschworen, diesem schwarzen Ballermann-Kommerz-Karnevals-Jahrmarkt in Zukunft nicht wieder mein Geld in den Rachen zu werfen. Aber die dazwischen liegenden Jahre haben mich wohl vergesslich gemacht. Außerdem waren tatsächlich einige tolle Bands auf dem Plan. Die wenigen gruftigen Künstler konzentrierten sich weitestgehend auf den Samstag, weshalb ich mir lediglich eine Tageskarte besorgte. Die Intensität, mit der dann die Erwartung auf die gegebene Realität traf, hat zur Folge, dass ich meinen Schwur, das Amphi nie wieder zu besuchen, hoch und heilig erneuere.

Die Lanxess-Arena als neue Location schafft es, dieses an sich schon nicht leicht verdauliche Festival noch unerträglicher zu machen. Die Hauptbühne stellt die riesige Beton-Arena mit dem Charme eines Luftschutzbunkers dar, um den sich ein Rundgang zieht, der mit Fressbuden (Pommes, Pizza, Bratwurst, Bier) vollgestopft ist. Der Geruch nach Fett, die sich durch den Gang (von mir auch „letzter Höllenkreis“ getauft) quetschende Massen an größtenteils unsympathischen Menschen, ein ununterbrochenes Dröhnen und das unterschwellige Bum-Bum der von innen kommenden “Musik“ charakterisierten dieses waagerechte Hamsterrad. So eine feindliche Atmosphäre muss man beim Reinkommen erst mal verarbeiten.
Programmhefte mit Lageplan wurden anscheinend bei der Bändchenausgabe nicht obligatorisch, sondern optional vergeben. So hatte ich Glück, wurde aber von anderen Besuchern darauf angesprochen, wo ich denn dieses praktische Heftchen her hätte, so etwas hätte man nicht bekommen. Der Lageplan brachte mir auf Anhieb allerdings auch nicht viel, denn trotzdem irrte ich erst mal ziellos umher, auf der Suche nach den Open-Air-Bühnen, die man einfach auszuschildern sich nicht die Mühe gemacht hatte. Will mir gar nicht vorstellen, wie verloren sich die Leute ohne Programmheft zunächst gefühlt haben müssen. Als die Bühnen dann lokalisiert waren, brachte das auch nichts mehr, denn es fanden kommentarlos keine Konzerte statt. Wie sich später rausstellte, gab es eine Sturmwarnung.
Dass die Konzerte draußen ausfielen, erfuhr man allerdings durch „learning by (not) doing“, denn die zig Monitore im Höllenkreis bildeten stur nur die Spielpläne, unterbrochen von Werbung, ab. Auch die tollen Lautsprecher wurden nicht wirklich sinnvoll eingesetzt, stattdessen erfuhr man alle fünf Minuten, dass die Fressbuden auf Ebene 6 geöffnet seien. Wundervoll. Stichwort Ernährung: Die veganen/vegetarischen Imbisse waren leider ebenfalls gestrichen, da sie im Außenbereich zu finde gewesen wären. Dabei fällt mir ein, dass ich auch noch die (vermutliche) Pommessoße von den Pikes putzen muss…
Bei den Facebook-Kommentaren auf der Amphiseite stößt man immer wieder auf die Legitimation, man hätte ja nichts für das Unwetter gekonnt. Stimmt, dafür kann man nichts. Wofür man allerdings was kann, ist der grottige Informationsfluss beziehungsweise den Mangel an selbigem. Man wurde buchstäblich im Regen stehen gelassen. Zudem wussten wir schon eine Woche vorher, wie das Wetter werden würde. Es muss doch eigentlich genug Zeit gegeben haben, um sich einen besseren Notfallplan auszudenken. Stattdessen wortlos und scheinbar ganz überrascht die Konzerte zu streichen? Nein, solch ein Maß an Inkompetenz und Verarsche ist inakzeptabel. Zugeben, ich bin an sich schon kein Freund von Open-Air-Konzerten, besonders im Sommer. Entweder man wird in der Sonne gebraten oder man wird nass. Ein Vorteil des Tanzbrunnens: Es gab nur eine Außenbühne (die sogar noch überdacht) und zwei innen, jetzt ist es genau andersherum, denkbar unpraktisch also.
Als Besitzer einer Tageskarte für Samstag war man angeschmiert. „The Devil & The Universe“ und „Lebanon Hanover“ als zwei der wenigen Vertreter düsterer und/oder intelligenter Musik auf diesem Festival waren auch die zwei Bands, welche nicht Sonntag nachgeholt wurden, im Gegensatz zu den meisten (oder allen?) anderen am Samstag ausgefallenen. Lebanon Hanover schrieben bei Facebook: „sorry again to everybody. there was no slot to be found for us to fit in. too many bands. […]“, worin sich eventuell die musikalische Priorität dieses Festival wiederspiegelt: Die einzige Cold-Wave-Band passt nicht mehr rein…
Selbst wenn sie Sonntag nachgeholt worden wären, hätte es mir natürlich nichts gebracht. Auch für mich potentiell interessante Bands wie „Aeon Sable“ und „Inkubus Sukkubus“ fielen am Samstag weg. DAF wurde zwar nach innen verlegt (wovon ich dank der, wie schon erwähnt, hervorragenden Kommunikation erst nach dem Konzert erfuhr), doch ich habe mir sagen lassen, dass der Sound grottig gewesen sei. Davon konnte ich mich dann am späten Abend nach Stunden, die mehr oder weniger mit Langeweile gefüllt waren, auch beim Konzert von Goethes Erben überzeugen. Der Sound in der Halle ist halt, wie man sich Arena-Sound vorstellt: Breiig und lärmig. Man verstand die meisten Worte kaum oder gar nicht. Die kalte, unpersönliche Atmosphäre dieses Massen-Stadions kann selbst ein Goethes-Erben-Konzert nicht erwärmen. Für Semino Rossi und Mario Barth reicht es aber sicher.
Zurück bleibt die Reue über das viele Geld. Positiv aufgefallen sind mir die Toiletten. Auf Klo gehen und Geld ausgeben konnte man also hervorragend. Aber ob das genug ist? Für mich definitiv nicht. Man fühlt sich einfach wie am falschen Ort gelandet. Ob mit oder ohne Sturm. Ja, unter anderen Umständen wäre die Kritik vielleicht nicht so vernichtend ausgefallen, doch wie mit der Situation umgegangen wurde, spricht Bände. Das Amphi hat mit dem Umzug, dessen Hauptgrund wohl die Vergrößerung der Besucherzahl ist, ein Maß an kommerzieller Seelenlosigkeit erreicht (oder konsequent beibehalten?), auf das ich mich nicht mehr einlassen möchte. So ging es auch den Leuten, mit denen ich dort war. Fazit: Selbst schuld. Siehe Textanfang. Wer nicht (auf sich selbst) hören will, muss fühlen. (Text: Mourant, Bilder: Wikipedia, Mone vom Rabenhorst, Rania Tsironas)