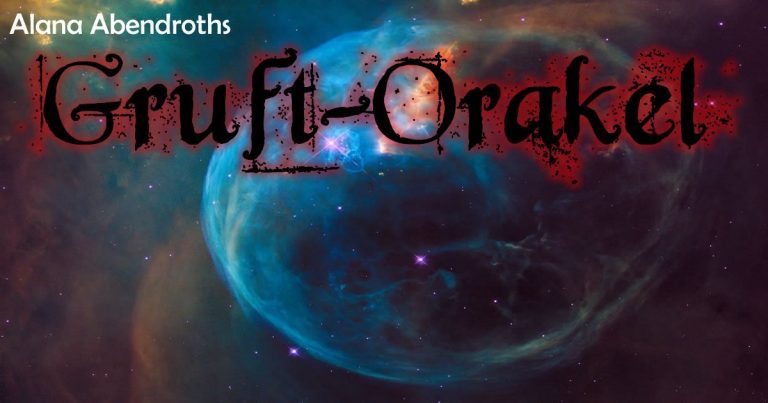Der Winter hatte noch gar nicht richtig angefangen, da steht auch schon der Frühling vor der Tür und dennoch fühlt sich die Welt immer noch wie Winter an. Eisig, stürmisch und leblos. Krieg in der Ukraine, eine Pandemie, die immer noch nicht vorbei zu sein scheint und Menschen, die nach 2 traurigen Jahren die Wände hochgehen. Das alles endet in einer toxischen Internetkultur, weil ein echter Austausch mit den Menschen Mangelware geworden ist. Auch mir geht nach einer langen Zeit ohne einige spärliche Sozialkontakte und ohne Urlaub und Zeitvertreib auch manchmal die Hutschnur hoch und ich verliere mich in Meinung statt in Fakten. Allerdings tun mir die wenigen unvermeidlichen Sozialkontakte auch nicht wirklich gut. In meinem Umfeld regt man sich mehr über Spritpreise auf, als mit der Angst vor einer neuen russischen Bedrohung umzugehen. Vielleicht bin ich aber auch der Dumme in dieser Gleichung. Alles bleibt ungerecht.
Ermordung von Sophie Lancaster: Täter Ryan Herbert soll aus der Haft entlassen werden | BBC
2008 wurde Sophie Lancaster zu Tode geprügelt, weil sie ein Goth war. Einer der Haupttäter, Ryan Herbert, der seinerzeit zu lebenslanger Haft verurteilt wurde konnte jüngst vor dem Bewährungsausschuss seine Rehabilitierung glaubhaft machen und scheint jetzt aus der Haft entlassen zu werden. Ein Statement von Sophie Lancasters Mutter macht deutlich, dass sie diese Entscheidung empörend findet: „Wieder einmal haben wir ein Justizsystem, das keine Gerechtigkeit schafft.“ Der Bewährungsausschuss und der vorsitzende Richter sind zu dem Schluss gekommen, Herbert hätte „große Fortschritte gemacht“ und sein für eine Bewährung geeignet. Sophie Lancasters Ermordung stand immer wieder im Focus der Berichterstattung nicht zuletzt, weil Sylvia, die Mutter des getöteten Teenagers sich mit ihrer „Sophie Lancaster Foundation“ gegen das Vergessen stark gemacht hatte. Die Frage, die sich nun stellt, ist schwierig. Wann ist der Gerechtigkeit Genüge getan? Hat ein Mörder, der bei seiner Tat 16 Jahre alt war, nach rund 14 Jahre Haft und Rehabilitierung genug gebüßt?
Musik, Jugendkulturen und Beteiligung | Journal für politische Bildung
„Die Jugend muss geschützt werden, ob sie will oder nicht!“ Aber wovor eigentlich? Im breiten Angebot der Musik gibt es unzähligen Bands und Songs, vor denen man „warnen“ möchte, die eine Gefahr für die Jugend darstellen. Eine Lösung ist das allerdings nicht: „Sexismus, Rassismus und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit befriedigen Bedürfnisse. Sie bieten vor allem selbst marginalisierten, gesellschaftlich nicht mächtigen, persönlich wenig selbstbewussten und bildungsfernen (jungen) Männern die Chance, sich selbst zu erhöhen, indem sie andere weiter erniedrigen, die auf der Leiter der gesellschaftlichen Hierarchie (vermeintlich) noch unter ihnen stehen (noch „Schwächere“). Niemand wird zum Schwulenhasser, weil er homophobe Musik hört, oder zum Nazi, weil er Rechtsrock hört, sondern er hört diese Musik, weil sie seine Bedürfnisse befriedigt, seine Lebenseinstellung widerspiegelt.“
Sie will einen Geist heiraten. Noch streitet man über das Datum | Metro
Sie möchte nämlich eher im Sommer heiraten, obwohl Eduardo, der Geist eines viktorianischen Soldaten, die Hitze überhaupt nicht mag. „Brocarde, 38, is a singer songwriter from Oxfordshire and fell in love with Edwardo – who she says is the ghost of a Victorian soldier – last year. Edwardo appeared in her home and they have been together since. ‘Edwardo and I are currently arguing over the wedding date,’ Brocarde says. ‘I want a summer wedding but he hates the heat and I’d secretly love to make him melt, but he disappears often enough as it is.“ Auch die Moderatoren im Frühstücksfernsehen versuchen, ihr angemessen zu lauschen.
Italien: Frau sitzt mehr als zwei Jahre tot an ihrem Küchentisch | Spiegel
Niemand hatte sie vermisst, es gab keine lebenden Verwandten und die Nachbarn dachte, die 70-jährige Frau sei mit Beginn der Pandemie weggezogen. Was sie aber nicht. Die Frau, die keine Miete zahlen musste, weil sie im Haus lebenslanges Wohnrecht genoss, wurde zufällig entdeckt, als man einen umgestürzten Baum vor ihrem Fenster entfernte. „In Italien löste der Fund Bestürzung aus. Familienministerin Elena Bonetti schrieb auf Facebook: »Was in Como passiert ist, die vergessene Einsamkeit, verletzt unser Gewissen. Wir haben die Pflicht, uns als Gemeinschaft, die vereint bleiben will, an ihr Leben zu erinnern.« Niemand dürfe alleingelassen werden.“
Neu ab April: „Our Darkness. Gruftis und Waver in der DDR“ | Dennis Burmeister und Sascha Lange

Am 1. April erscheint das neue Buch von Sascha Lange und Dennis Burmeister, die sich schon mit „Depeche Mode: Monument“ und „Behind the Wall“ einen Namen gemacht haben. Diesmal geht es weniger um Depeche Mode, sondern vielmehr um die „Schwarze Szene“ der 80er in der DDR. In der Beschreibung zum Buch heißt es: „Aus geschmuggelten Bravos und dem Jugendradio DT64 suchten sich Jugendliche in der DDR ab Mitte der Achtziger ihre Informationen zur Waver- und Grufti-Jugendkultur zusammen, bastelten sich in vielen Stunden ihre eigenen Interpretationen des Outfits und schufen sich eine eigene, selbst geschaffene kulturelle Heimat. Auch die zahlreichen Anfeindungen durch Faschos und den DDR-Sicherheitsapparat konnten die Ausbreitung dieser Jugendkultur nicht stoppen. Legendärer Höhepunkt war am 4. August 1990 das erste Konzert von The Cure in der DDR.“
Aus den Trümmern zu den Sternen | Deutschlandfunk Kultur
Zu feige, um Steine auf die Polizei zu schmeißen, zu revolutionär, um in Starre zu verharren. „Wir haben akustische Steine geschmissen, also kulturell zersetzt, das System aufgelöst.“ Deutschlandfunk Kultur hat ein Feature über die elektronisch-musikalisch Pioniere von Kraftwerk und Tangerine Dream gemacht. „Konzeptionell tritt die Band hinter ihre Musik zurück. Dazu passt, dass Kraftwerk uniform auftreten: Stoffhose, Hemd, Krawatte, die Haare kurz und geschniegelt. Die vier Musiker sehen aus wie Buchhalter, die an Stehpulten auf der Bühne ihrer Arbeit nachgehen: emotionslos, kühl. Ohne einen Tropfen Schweiß zu vergießen. Popjournalist Max Dax fasst das so zusammen: „Kraftwerk haben Musik nicht nur als Jam oder Musikmachen begriffen, sondern sie haben versucht, die Welt zu erfassen und das in Musik und Texte zu fassen.“
(Danke an Wiener Blut)
Wiederbelebung einer totgeglaubten Subkultur? „Emo Girl“ von Machine Gun Kelly | Musikexpress
Machine Gun Kelly ist nicht nur der medienwirksame Schwarm von Transformers-Star Megan Fox, sondern auch Musiker. Zusammen mit der 22-jährigen Tochter von Will Smith, Willow, hat er jetzt die Single „Emo Girl“ veröffentlicht. Manche erkennen bereits darin einer Wiedergeburt einer Subkultur, ich würde es als aufwärmen eines Styling-Konzeptes werten. Allerdings ist das Stück musikalisch so belanglos, dass ich es mal in Wochenschau verbanne. Die Formel Goth werde ich mir mit der musikalischen Seuche jedenfalls nicht zukleistern.
Dance Like a 90’s Goth With Me | Angela Benedict
Weil ja am 20. März sowas ähnliches wie ein „Freedom Day“ in Sachen Corona Pandemie war, und viele Discotheken der schwarzen Szene wieder knirschend ihre Pforten öffnen, kommt ein Tanz-Video genau richtig. Nur für die Gefahr, dass man nach 2 Jahren einige Moves vergessen hat.