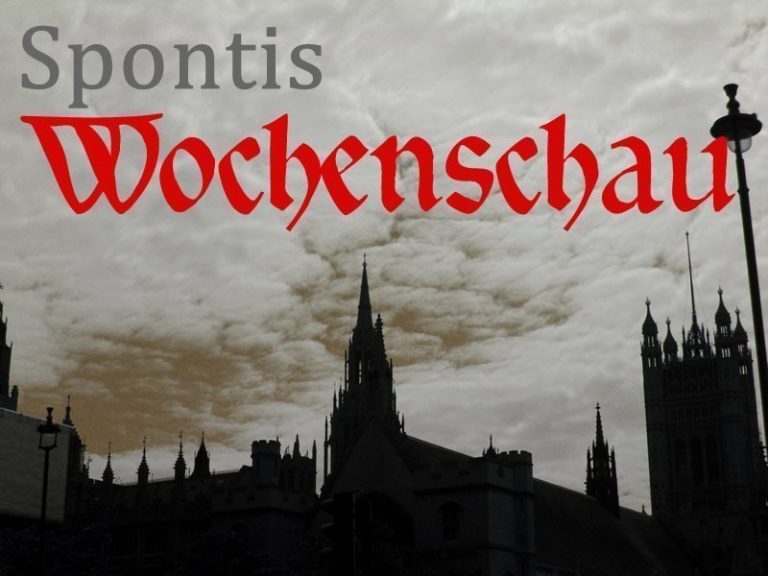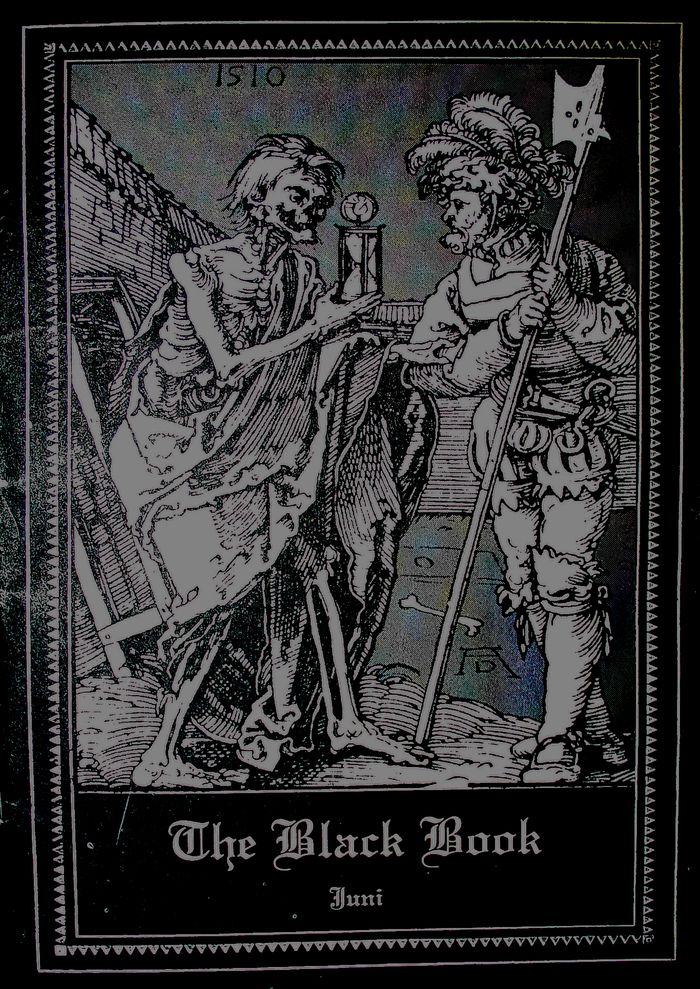Gewonnen. Oder wahlweise verloren. Wieder einmal hat die musikalische Lust gewonnen und die guten Vorsätze verloren. Was haben wir über das Amphi-Festival in Köln geschimpft. 2011 nannten wir es „Gothic Karneval mit Schattenblicken“ und 2012 war es gar das „Little Amphi of Horrors„. Das müssen wir uns nicht mehr antun, lautete unser persönliches Resümee kurz nach dem Amphi. Wir müssen kleine Festivals besuchen und darüber berichten! Das ist nicht unsere Szene! Im Laufe des vergangenen Jahre bröckelte der eiserne Standpunkt jedoch kontinuierlich. Phillip Boa, Alien Sex Fiend, Fields of the Nephilim, Anne Clark, Diary of Dreams oder auch Rosa Crvx, mit jeder Bandbestätigung wurde fraglicher ob wir unsere guten Vorsätze halten könnten. Dann erfuhren wir auf dem WGT, dass einige sehr liebe Menschen dem Amphi ebenfalls ihre Aufwartung machen wollten. Das Fundament zerfiel. Und ja, auch die Gespräche mit einigen von Euch, die rieten, wir sollen doch das Ganze „drumherum“ ignorieren sorgten für die letztendlich Entscheidung. Wir werden es versuchen. Die Karten hängen an der Pinnwand, die Vorfreude stellt sich ein. Alle guten Vorsätze dahin? Beim schreiben dieser Zeilen komme ich mir vor, als hätte ich wieder mit dem Rauchen angefangen. Die Lust auf Bands, die man immer schon mal wieder sehen wollte, hat gewonnen, die Moral hat verloren. Jedenfalls ein bisschen. Schließlich haben wir auch noch einige kleine Festivals auf dem Programm und berichten hier immer wieder über „andere“ Veranstaltungen, wie beispielsweise das Gothic-BBQ.
- Das Blogger-Rückblick-Special zum WGT 2013
Ein Festival und tausende Wahrnehmungen. Niemand hat wohl das exakt gleich Wave-Gotik-Treffen 2013 erlebt. Andere Bands, andere Partys, eine andere Reihenfolge und andere Prioritäten. Nachdem wir bereits unsere subjektiven Rückblicke verfasst haben, ist es Zeit zu lesen, was andere erlebt haben. Und das alles nur, um die Wartezeit bis zum Pfingstgeflüster angemessen zu überbrücken.- Gesprächsmäander und Worttsnuamis – das Wave-Gotik-Treffen 2013 | Gedankensplitter
„Ja, Musik gab es durchaus. Beispielsweise den recht emotionalen Auftritt von „Das Ich“, vor dem allerdings zuerst das Durchschreiten der Agra-Flaniermeile bewältigt werden musste. Ein buntes Treiben. Zu bunt. Zu laut. Diverse Gerüche überlagerten sich. Seltsame Verkleidungen im Augenwinkel. „Stimmungsmusik“. Erinnerungen an Volksfeste wurden geweckt. Keine allzu schönen. Nach wenigen Minuten war der Spuk vorbei. Der Halleneingang in Sicht. Durchatmen. Ein tolles Konzert entschädigte für diesen unvermeidbaren Ausflug in eine Welt, die mich zu sehr an die bunte Spaßgesellschaft erinnerte, zu der man sich ursprünglich einen Gegenpol schaffen wollte.„ - Mein ABC des WGT 2013 | Der schwarze Planet
„Bei diesem WGT war jedenfalls so Einiges anders, aber meinen Realitätsverlust in diesen 5 Tagen habe ich dennoch wieder ausgiebig genossen! Nur war ich eben letztes Jahr mit Eindrücken hinterher etwas praller gefüllt […] Ich plädiere dafür, dass der WGT-Blues zu einer anerkannten Geisteskrankheit erklärt wird, wegen der man die restliche Woche nach Pfingsten daheimbleiben und sich von der aufkeimenden Realität erholen kann.„ - Tiefenentspannt in Leipzig – eine WGT-Nachlese | Rosa Chalybeia
„Auch daß wir so ziemlich alle Stressfaktoren umschifft haben war herrlich – kein victorianisches Picknick a.k.a Knipssnick, kein Knippserterror in welcher Form auch immer. Und Konzertmarathons sind einfach auch nicht mein Ding. Ich jedenfalls hab mich rundum wohl gefühlt – jetzt mal unabhängig ob es um Treffen, Freunde, Bekannte, Veranstaltungen oder die heurige Klamottenwahl geht. Es war wie gesagt anders, aber eben gut anders – faszinierend war auch der andere Blickwinkel, bedingt durch den Rockverzicht – aber darüber könnte man einen eigenen Artikel schreiben.„
- Gesprächsmäander und Worttsnuamis – das Wave-Gotik-Treffen 2013 | Gedankensplitter
- Das satanische Leben – Einblicke in unsere Welt | Black Magazin
„… meldet sich der engagierte Kleinverlag von Lars Kronlob mit Das Satanische Leben – Einblicke in unsere Welt zurück. In dem im amerikanischen Original bereits 2007 erschienenen Band liefern 11 Mitglieder der Church of Satan zum Teil sehr persönliche Berichte über ihren Weg zum Satanismus und erläutern, wie sie das satanische Weltbild in ihrem Leben umsetzen. So erzählen die Tierschützerin Magda Graham, der Journalist Joel Gausten sowie die Verlegerin und Horrorautorin Scarlet Norton ausführlich und mit großer Offenheit, wie die Schriften Anton LaVeys ihr Leben veränderten und ihnen halfen, ihren eigenen Platz in dieser Welt zu finden. In drei Essays findet sich praktische Lebenshilfe aus der Perspektive des Gehörnten: Shiva Rodriguez hält ein flammendes Plädoyer für den Individualismus, Corvis Nocturnum gibt Tipps, wie sich Kontakte mit der Masse Mensch vermeiden lassen und Diana DeMagis erläutert in bester survivalistischter Manier den Sinn von Vorratshaltung und privatem Katastrophenschutz.„ - „Die letzte Instanz“ – Ein Livehörspiel braucht Unterstützer | Clockworker
Gothic oder nicht, die Idee ist toll und sollte Nachmacher zum nachmachen animieren: „Hamburg – 1888: Früher Morgen auf dem Fuhlsbüttler Flugplatz. Eine Kutsche prescht heran und als sich die Nebel lichten taucht ein imposantes Luftschiff auf. Vier geladene Gäste, die unterschiedlicher nicht sein können, haben die Ehre das neuste Wunderwerk der Technik zu betreten um die Jungfernfahrt von Hamburg nach München zu erleben. Was sie nicht wissen ist, dass sie alle mehr als die Tickets eint. Noch ahnen sie nicht was für ein Grauen sie über den Wolken erwarten wird. Es geht um Schuld, Sünden, Buße und Erlösung. Doch die Reise endet für alle anders als gedacht. Ein rasanter Krimi als Live-Hörspiel in der Zeit von Jules Verne und Königin Victoria. Inszeniert in furiosen Wortgefechten, atemberaubenden Effekten und dramatischer Musik.“ – Weitere Informationen und Möglichkeit zum Unterstützen findest du HIER. - 7 most morbid Victorian mourning traditions | MNN
Sie fotografierten sich mit ihren toten Verwandten, trugen die Haare der Verstorbenen und brachten Klingeln an den Gräbern an, mit dem die Toten, die dann doch nicht tot waren, auf sich aufmerksam machen konnten. Jedes einzelne Thema würde Raum für einen eigenen Artikel bieten. „Halloween’s ghouls, goblins, ghosts and skeletons — we may get dark and creepy about death one day a year, but we’ve got nothing on the Victorians. While people of the 19th century were wildly repressed about many things, their comfort with death was a far cry from modern sentiments. Nowhere is this more evident than in British mourning etiquette during the time of Queen Victoria’s reign (1837 to 1901). The death of her husband, Prince Albert, in 1861 ushered in a rigorous display of mourning that set the stage for the general culture to follow. What became customary mourning, by today’s standards, seems downright macabre and morose.“ - 30 Jahre Chaostage – „So ein Leben hältst du nicht ewig durch.“ | einestages
Punk, oftmals als Lebenseinstellung idealisiert, war dann doch eine Jugendsünde. In einem wirklich tollen Bericht von Christoph Gunkel werden einstige Punks, die in erste Reihe dabei waren als es „Hoch her ging“, vorgestellt, die heute alles andere als rebellisch und dagegen sind. Anpassung als unweigerliche Konsequenz? Ein Artikel, der zum Nachdenken anregt. „Nach monatelanger Recherche hatte Eisermann aber doch zwölf Alt-Punks gefunden, die nicht nur bereit waren, mit ihm zu reden – sondern sich sogar ein zweites Mal von ihm fotografieren ließen. Beeindruckende Porträts sind daraus entstanden, denn viele der Draufgänger von damals sind heute in der Mitte jenes Bürgertums angekommen, das sie früher bespuckt hatten […]Von Brüchen in den Lebensbiografien möchte Fotograf Eisermann trotzdem nicht reden. Das klingt ihm zu hart, zu abrupt, für ihn ist es „kaum verwunderlich, im Alter bürgerlicher zu werden“. Und jene, die einfach so weitergemacht haben wie in ihrer Jugend? „Viele sind längst tot“, sagt Karl Nagel abrupt. „So einen Lebensstil hältst du nicht ewig durch.„ - Goth Picknick | VICE
Aus der Rubrik „Was Goth nicht sein sollte“ präsentiert mir VICE-Deutschland in meinem Postfach einen Link, den ich auch in einer Bravo aus den 80ern entdecken könnte. Gothic als Modelinie. Pur und ohne drumherum. Ob hier ein wenig Ironie mit im Spiel ist, überlasse ich dem Betrachtet, klar ist nur: Von „Goth“ ist hier garantiert keine Spur. - Gothic BBQ
Das Picknick auch andere Formen annehmen kann, zeigt das Gothic-BBQ, dass mittlerweile zum 5. mal in Nordhessen stattfindet. Am 31. August versammelt man sich wieder auf Decken um das Feuer. Wer den ersten Zweifel – „was hab ich denn mit BBQ am Hut?“ – überwunden hat, findet man im Programm des Treffens einige sehr interessante Ideen, die ich so noch auf keinem Festival gesehen habe: „Wir wollen mit Gleichgesinnten feiern, tanzen, musizieren und Spaß haben. Deshalb steht im Mittelpunkt das große Feuer und das Musikzelt. An den Ständen wird mit Grillgut und Getränken zu fairen Preisen für euer leibliches Wohl gesorgt – an die Vegetarier unter uns wird natürlich auch gedacht. Um das Feuer herum, sowie an manch anderer Stelle gibt es Sitzgelegenheiten. Das Feiergelände lädt jedoch auch dazu ein, sich eine Decke mitzubringen, um sich niederzulassen, wo es einem Jeden gefällt. Zwischen den beiden Türmen darf unter einem riesigen Fallschirm getanzt werden, für ausreichend Beschallung sorgt unser Resident DJ und wechselnde Gast-DJs mit einem Querschnitt durch alle “schwarzen” Genres. Für extrovertierte Seelen findet am Rande des Feiertrubels traditionell ein semiprofessionelles Fotoshooting statt. Wer Lust hat, kann sich gern an einem vorbereiteten Set mit Durchlichtschirmen und allem, was dazu gehört, ablichten lassen. Die Bilder werden im Anschluss an das BBQ auf dieser Website und auf facebook präsentiert. Ein besonderer Tipp ist die kleine Drachenhöhle, ein ehemalige Fluchtstollen in der Nähe. Nur spärlich von Grabkerzen beleuchtet, akustisch von der Außenwelt abgeschlossen und mit Strohballen ausgestattet dürft ihr wechselnden Klangereignissen lauschen. Dies können nervenaufreibende Hörspiele aber auch Dark-Ambient Klangwelten sein. Bringt eure Instrumente und/oder eure Stimme mit! Im Musikzelt stehen Trommeln und eine Gesangsanlage zum jammen und gemeinsamen musizieren bereit – Es mischen sich auch immer wieder Künstler aus der Szene unter die Sessions.„ - Handwerker bauen Stadt mit Werkzeug des Mittelalters | Nerdcore
Innerhalb der nächsten 40 Jahre soll eine Stadt aus dem 9. Jahrhundert entstehen. Nur mit den Methoden des Mittelalters. „40 Jahre soll das Projekt dauern. Im süddeutschen Meßkirch bauen Handwerker an einer mittelalterlichen Stadt samt Kathedrale. Sie schuften für niedrige Löhne, haben wenig Freizeit – und arbeiten mit dem Werkzeug des 9. Jahrhunderts.“ Die Franzosen kennen das schon eine Weile, denn die bauen in Guédelon eine Burg. Hier noch eine Doku:
- You rang, Mr. Addams? | Pixella Bloggt
Kurze, aber sehr informative Dokumentation über Charles Addams, der als Zeitungs-Karikaturist beim „New Yorker“ begann und sich zum kreativen Vater der „Addams Family“ entwickelte. Die spätere Fernsehserie mauserte sich zum Meilenstein der Grusel-Komödie und wird in regelmäßigen Abständen auch heute noch wiederholt. Es wird übrigens wieder einmal Zeit, liebe Programmdirektoren, solange begnüge ich mich mit YouTube.