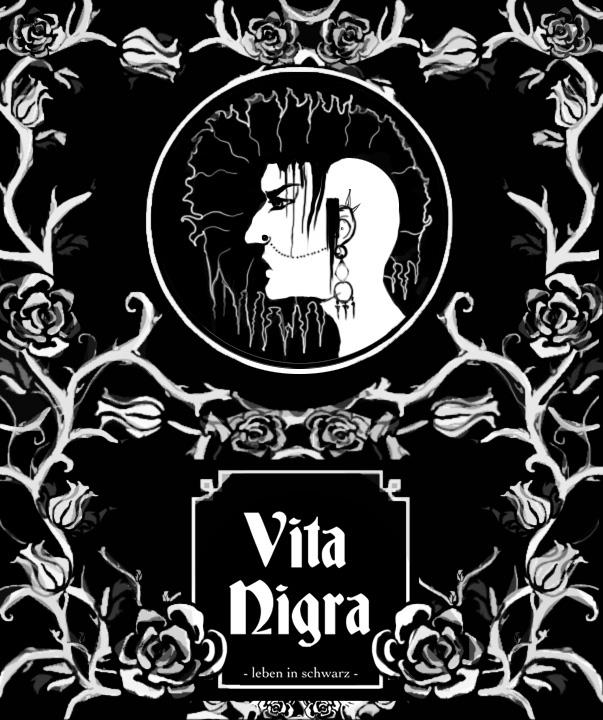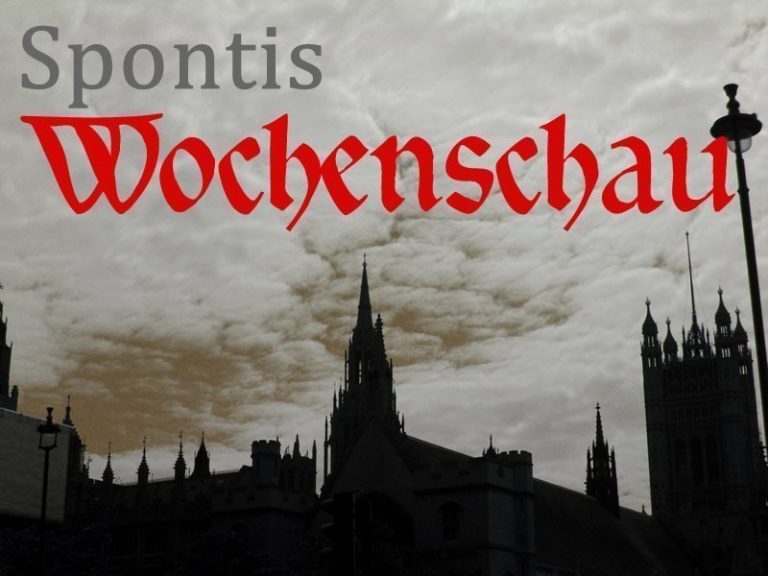In guter alter Tradition möchte ich euch auf das kommende WGT einstimmen. Wie einige bereits wissen, habe ich einige Artikel für das Pfingstgeflüster von Marcus Rietzsch beisteuern dürfen, in denen ich mich mit den Besuchern und ihren Gedanken beschäftige. Für die Ausgabe 2012 habe ich mit den Besucher eine Reise gemacht und zusammengefasst, was in vielen vielen Fragebögen an Reiseberichten zusammengetragen wurde. Wer das gedruckte Pfingstgeflüster 2012 noch nicht zu seiner Sammlung zählt, sollte HIER vorbeischauen und umgehend bestellen – es gibt keine bessere Reiselektüre für Pfingsten. Mein Dank für die freundliche Genehmigung und die tollen Bilder gehen an Marcus, dem Mann, dem nie die Friedhöfe ausgehen.
Mit dem 21. Lebensjahr ist die Zeit des Heranwachsens vorbei. Man gilt nun vor sämtlichen Institutionen als Erwachsener. Das Wave-Gotik-Treffen ist schon lange vor seinem 21. Jahr erwachsen geworden. Manche behaupten sogar, es altert bereits. Dabei ist lediglich der Altersquerschnitt der Besucher immer breiter geworden. Mittlerweile tummeln sich drei Generationen auf dem WGT, es ist Normalität geworden, daß die Oma ihre Enkel trifft oder die Eltern mit ihren Kindern unterwegs sind. Und für kaum jemanden ist es das erste Treffen dieser Art.
Das Wave-Gotik-Treffen ist wie ein Zug, in den immer wieder Reisende ein- und aussteigen, während andere länger unterwegs sind und manche gar nicht wissen, wohin sie eigentlich wollen. 20000 schwarze Reisende auf der Suche nach ihrem Abteil, mit einer Reservierung für ihren Stammplatz oder auch als Passagier in einem der Großraumwaggons.
Einsteigen und die Türen schließen

(c) Markus Rietzsch – Pfingstgeflüster
Was bewegte die Besucher eigentlich dazu, in den Zug WGT 2012 einzusteigen? Ist das Ganze immer noch in seiner Definition als Jugendkultur begründet? Die Zahl derer, die mit den Anfängen der Szene erwachsen geworden sind, steigt stetig. Immer mehr Quereinsteiger entdecken ihren Weg in die schwarze Subkultur. Jugendbewegung? Fehlanzeige! Es spielt offenbar keine Rolle mehr, mit welchem Alter sich jemand einer Szene zugehörig fühlt, daher muss die Antwort auf die Frage nach dem Einstieg woanders zu finden sein. Womöglich ist es die Faszination für das, was in der Szene zu finden ist, was Menschen dazu bewegt, den Schritt vom Beobachter zum Reisenden zu gehen.
Für DarAzar bietet diese Szene mit ihren unterschiedlichen Strömungen eine faszinierende Vielfalt. Sie bedeutet Freiheit und die Möglichkeit, die eigene Kreativität auszuleben und oft Neues in für ihn interessanten Bereichen zu entdecken: „Ich genieße es, mich in einem offenen Umfeld zu bewegen, in dem auch viel diskutiert und hinterfragt wird. Ich finde dort viele interessante und kreative Menschen, Musiker, Künstler und Fotografen, die mich ansprechen. Die Outfits, die damit verbundene Mühe und die Liebe zum Detail finde ich toll. Man mag der Szene dabei auf den ersten Blick eine gewisse Oberflächlichkeit vorwerfen, allerdings steht bei Einigen noch viel mehr dahinter. Man trifft innerhalb der schwarzen Szene viele aufgeschlossene, intelligente Leute, die sich tiefgründiger mit der Welt und auch schwierigen Themen auseinandersetzen; so etwas fasziniert mich und ist in anderen Szenen nicht zu finden.“
Auf Fille de Porcelaine übt hingegen die Eleganz eine große Faszination aus: „Es ist einfach beeindruckend, ästhetische und zu gleich gut gekleidete Personen zu sehen, die sich dazu auch noch gut zu benehmen wissen und oftmals einen kleinen Hang zum Morbiden haben. Was die Musik betrifft, lässt sich meist Ähnliches sagen: Es ist alles viel stimmiger, viel – so düster es auch sein mag – liebevoller und allgemein mit ein wenig mehr Bedeutung als das, was einem sonst so in die Ohren schwebt.“
Und Undómiel hat „den Eindruck, daß es im Vergleich zu ‚normalen’ Menschen relativ gesehen mehr Leute gibt, die sich Gedanken über die Welt machen und Geschehnisse und Prozesse hinterfragen.“ Sie denkt, daß „viele Szenemitglieder Dinge, mit denen sie unzufrieden sind, nicht einfach hinnehmen, sondern den Willen haben etwas zu ändern. Alte Werte, die in der heutigen Gesellschaft immer mehr verkommen, werden von einigen noch befolgt.“ Dennoch sieht Undómiel „leider eine Tendenz in Richtung oberflächliches Partyvolk“, was sie sehr traurig stimmt.

(c) Markus Rietzsch – Pfingstgeflüster
Ist man einmal eingestiegen, beginnt man mit der Suche nach seinem Abteil. Man läuft durch die Gänge des Zuges WGT und wirft neugierige Blicke auf die vielen Facetten, die sich mittlerweile einen Platz gesichert haben.
Nischendasein
Täglich denken wir in Schubladen. Es ist aber auch unglaublich einfach. Ein bunter Irokesen-Haarschnitt und zerrissene Strumpfhosen? Ein Batcaver. Pikes und Pluderhose? Ein Waver. Neonfarbene Haarverlängerungen und Gasmaske? Ein Cyber. Kampfstiefel und Militärhose? Ein EBMler. Die Liste ließe sich beliebig erweitern. Ganz ähnlich ist es mit dem Musikgeschmack. Bei Combichrist erwartet man den Cyber, bei Feindflug den EBMler und die Batcaver gehen bestimmt zu Alien Sex Fiend.
Doch irgendetwas stimmt nicht. Man sitzt an der AGRA, beobachtet die vorbeiziehenden Gestalten und ist verwirrt. Es scheint so, als hätte man alle äußerlichen Stilrichtungen in einen großen Topf geworfen, sie umgerührt und aufgekocht. Ständig ist man gezwungen, neue Schubladen zu beschriften. Man ist schon fast froh, wenn sich der eine oder andere einer bestehenden Kategorisierung fügt. An den Veranstaltungsorten zeichnet sich ein ganz ähnliches Bild, kaum eine Band versammelt ein einheitliches Publikum vor der Bühne.
Fragt man die Besucher nach ihrer Nische, so wird deutlich, daß kaum jemand sich eindeutig zuordnet, niemand will in eine Schublade gesteckt werden. Individualität wird großgeschrieben.
So fühlt sich der Besucher Dekadenz der Szene, an der er vielseitig interessiert ist, im Ganzen zugehörig und nicht einer kleinen Nische. Was auch der Grund ist, sich nicht selbst eingrenzen zu wollen – zumindest nicht innerhalb einer Subkultur, die ihm „als Gesamtes viel Selbstbewußtsein verliehen hat“. Marquise de Noir bezweifelt, daß es eine einheitliche Szene gibt: „‚Die Szene’ gibt es nicht. Es gibt in meinen Augen nur ein paar Schnittpunkte wie die Farbe ‚Schwarz’, ein Interesse an Kultur, Geschichte, Übersinnlichem, Fantastischen, die Liebe zur Musik und zur ausgefallenen Kleidung, egal ob das rüschigen Prunk, Plastikschläuche als Haarschmuck, Lack und Leder oder eben mittelalterliche Gewandung beinhaltet.“ Und das genau macht für sie den Reiz aus, die Vielfalt, die Kreativität und die Liebe zum Detail und zur Ästhetik. „Darin liegt meiner Meinung nach auch die relative Friedlichkeit innerhalb ‚der Szene’ begründet – getreu dem Motto ‚leben und leben lassen’.“ findet Marquise de Noir.

(c) Markus Rietzsch – Pfingstgeflüster
Wir sind Individualisten. Rein statistisch gesehen gibt es keinen zweiten Menschen auf dieser Erde, der die gleichen Fähigkeiten, Neigungen, Talente und Charaktereigenschaften hat. Schubladendenken, so der einheitliche Tenor, ist negativ. Aufgeschlossen bemühen wir uns, niemanden einzusortieren, alles ist erlaubt, jeder Musikgeschmack willkommen und doch stört uns so manches aus dem Topfinhalt, der sich als zähe Masse auf der AGRA-Flaniermeile ergießt. Fehlendes Abgrenzungsverhalten auf Kosten maximaler Individualität?
Zwischen Individualität und Szene-Treffen
Betrachtet man das Geschehen in Leipzig und die mitunter wild gestylten Menschen von außen, so stellt man sich unweigerlich eine Frage: Was bringt 20000 Menschen dazu, sich Jahr für Jahr in Leipzig zusammenzufinden? Man merkt schnell, daß es sich nicht nur um ein Festival handelt, sondern um ein Szene-Treffen, bei dem Individualisten zu ihren Gemeinsamkeiten finden. Hier steht das Miteinander im Vordergrund, die Musik sorgt für die richtige Atmosphäre.
Die großen Unterschiede zwischen Festivals im Allgemeinen und dem Treffen im Besonderen werden von den meisten Besuchern durchaus gesehen und geschätzt. „Natürlich ist es die gesamte Atmosphäre des Treffens, die sich durch die Stadt zieht und mit keinem Festival vergleichbar ist. Im Gegensatz zu Festivals steht für mich hier nicht die Musik im Vordergrund, sondern der Treffencharakter, das Miteinander, das Kennenlernen neuer interessanter Leute, das Treffen alter Freunde. Das Gefühl, unter sich zu sein, und trotzdem auf eine ganze Stadt verteilt zu sein, nicht nur auf ein enges Festivalgelände begrenzt. Am selben Abend mit fremden Leuten Gespräche darüber führen zu können, warum Pinguine besser als Menschen sind, worin der Sinn des Lebens liegt, wie verfallen die Gesellschaft ist – oder eben einfach Spaß zu haben und zu feiern.“ – so drückt es Sarah treffend aus.

(c) Markus Rietzsch – Pfingstgeflüster
Das riesige Alternativprogramm neben den vielen interessanten Bands und die außergewöhnlichen Leute, die das WGT so einzigartig machen, begeistern Dekadenz, der ergänzt: „Auch wenn es in einigen Punkten am WGT etwas auszusetzen gibt, so fühle ich mich jedes Jahr für die paar Tage in Leipzig heimisch. Ich erinnere mich noch sehr gut an meinen ersten Besuch auf dem WGT: Ich stieg an einem Freitag aus der Straßenbahn am Agra-Gelände aus und es überkam mich ein Gefühl der Geborgenheit. Vielleicht läßt es sich auch am besten mit ‚Familie’ beschreiben.“
Miez hatte kurz vor dem WGT einen Unfall, weshalb sie die Zeit in Leipzig im Rollstuhl verbringen musste. „Bevor wir fuhren, hatte ich mir totale Sorgen gemacht und dachte, ich könnte überhaupt keinen Spaß haben und daß ich vielleicht doch lieber nicht fahren sollte. Aber das WGT und vor allem auch alle Besucher, haben es mir so schön gemacht, als hätte ich selbst laufen können. Im Grunde hatte ich gedacht, daß ich mein WGT größtenteils im Heidnischen Dorf und an der Agra verbringen müsste. Aber weit gefehlt. Von den Rollstuhltribünen aus hat man die allerbeste Sicht und einmal durfte ich sogar halb in den Journalistengraben vor der Bühne.“ Und sogar das Straßenbahnfahren war durch die Hilfe der Besucher kein Problem, denn viele packten an, um Miez beim Ein- und Aussteigen behilflich zu sein.
Und in der Tat ist es faszinierend, welchen Umgang man auf dem WGT miteinander pflegt. Vielleicht ist das ein Gegenpol zu unserer Ellenbogengesellschaft, in der man gezwungen wird, nur an sich selbst zu denken. Mag sein, daß darin eine Art neue Rebellion liegt. Die bewusste Entschleunigung des Alltags zugunsten eines friedlichen Miteinanders.
Kultur-Gut
Mit jedem Jahr des WGTs wächst auch das kulturelle Rahmenangebot. Immer wieder überraschen die Veranstalter mit neuen Angeboten, immer mehr Anhänger und Interessierte der Szene bringen sich aktiv in die Gestaltung der schwarzen Kultur mit ein. Das Treffen in Leipzig ist einzigartig, es lebt vor, wie man eine musikalisch begründete Szene mit Inhalten füllt.
Begeistert äußert sich Mandy Violetta über die von Jahr zu Jahr reichhaltigeren Angebote in den Bereichen Kunst und Kultur: „Besonders gefreut habe ich mich darüber, daß uns WGT-Gästen freier Eintritt in einigen Museen gewährt wurde. Ich liebe es, in Museen zu gehen, weil man hier mit Dingen aus der Vergangenheit konfrontiert wird, über die man sich sonst keine Gedanken machen würde. Man lernt einfach wahnsinnig viel – besonders über die Menschheit.“ Speziell einige tolle Kunstausstellungen haben ihr Herz höher schlagen lassen.
Ähnlich empfindet auch DarAzar: „Kunst und Kultur nehmen für mich einen hohen Stellenwert ein. Dementsprechend finde ich es gut, die Möglichkeit zu haben, auch viele Museen und Ausstellungen in ganz Leipzig während des WGT kostenlos besuchen zu können und auch, daß dieses Angebot stetig wächst. Ich interessiere mich sehr für Fotografie und für Kunst, die mit der Bearbeitung von Metall oder surrealen Skulpturen zu tun hat. Speziell die Ausstellungen in der Agra oder im Werk II haben mir gefallen.“ Bedauern äußert er nur darüber, daß im WGT-Plan kaum Informationen über diese Veranstaltungen zu finden sind. Eine Broschüre mit kurzen Zusammenfassungen zur jeweiligen Ausstellung, die man dem Plan beilegen könnte, wäre wünschenswert.

(c) Markus Rietzsch – Pfingstgeflüster
Für viele Besucher spielt die Musik sicherlich die größere Rolle, ist sie doch auch ein Stützpfeiler der Szene, doch Sylvie findet wie ihre Vorredner das Rahmenprogramm, welches auf anderen Festivals bei weitem nicht in diesem Umfang geboten wird, faszinierend und spannend. „Ich freue mich jedes Jahr darauf, die verschiedenen Angebote wie Ausstellungen, Varieté, Oper, Lesungen besuchen zu können, um meinen eigenen Horizont erweitern zu können. Einziges Manko sind hier für mich die teilweise sehr langen Wartezeiten, daher darf das kulturelle Angebot gerne weiter ausgebaut werden.“
Im Grunde waren es die Szene-Anhänger selbst, die Kunst und Kultur in der Szene etabliert haben. Heute interessieren sich mehr und mehr Besucher für das, was angeboten wird. Das Programmheft schickt den neugierigen Besucher auf eine Reise durch die unzähligen Facetten der schwarzen Kultur. Gothic, so gehasst und verallgemeinernd der Begriff auch sein mag, hat mehr zu bieten als Musik und Klamotten.
Kommerzpunk!
Eine Fahrkarte ist nicht umsonst, so viel ist klar. Die Reise muss bezahlt werden, die Angestellten, die für eine reibungslose Fahrt sorgen, wollen ihren Lohn. Und immer wieder bieten Händler den Reisenden ihre Waren an. Mit dem WGT wird Geld verdient. Mittlerweile ist es für Leipzig ein nicht mehr wegzudenkender Wirtschaftsfaktor, der an Pfingsten die Kassen füllt. Vielen Besuchern ist das klar und dennoch scheint dadurch etwas von dem verloren gegangen zu sein, was viele als „Inhalt“ bezeichnen würden.
So fällt vor allen Dingen die Sicht auf die Medien zwiespältig aus. „Ohne die Medien und den dazugehörigen Kommerz würde es heute manches vielleicht gar nicht mehr geben, deshalb sehe ich es als bittere Notwendigkeit. Es ist zwar nervig, daß sich überall diese Menschen mit Kameras um die beste Aufnahme prügeln, aber wenn man mal ehrlich ist, fast die Hälfte der Besucher möchte das doch auch. Nicht umsonst schleichen manche stundenlang vor dem Agragelände oder in der Stadt herum, anstatt das vielfältige Programm zu genießen!“ beurteilt Tina Abendstern kritisch das Verhalten diverser Fotografen und der sich zur Schau stellenden Besucher.

(c) Markus Rietzsch – Pfingstgeflüster
Auch DarAzar sieht die Notwendigkeit, „Geld zu verdienen und kostendeckend zu arbeiten, um vor allem auch Großveranstaltungen wie das WGT zu ermöglichen“. Allerdings betrachtet er „die Kommerzialisierung der Szene zunehmend als Problem“ und findet, „daß sie schon Einiges daran kaputtgemacht hat“. Dadurch sind „die ursprünglichen Gedanken und Ideen der Szene bei vielen Jüngeren verloren gegangen“. DarAzar sieht darin eine große Gefahr: „Die Tiefgründigkeit der Szene, aber auch die Bereitschaft zur Beschäftigung mit Poesie und Philosophie leiden darunter und das Ganze wird zunehmend oberflächlicher. Durch das exzessive Marketing, vor allem der Musikindustrie, wird die Szene ziemlich verwässert. Oscar Wilde hat gesagt: ‚Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, das Außergewöhnliche ihren Wert.’ Eben genau dieses für mich wertvolle, faszinierende Außergewöhnliche der Szene könnte durch die zunehmende Kommerzialisierung breitgetreten werden, wodurch schließlich diese Subkultur untergeht.“
Die Besucher haben es selbst in der Hand, wie sie ihr Treffen entwickeln. Subkulturellen Inhalt kann man nicht kaufen, man muss selbst dafür sorgen. Wenn man vom WGT zurückkehrt und merkt, daß nichts außer einem gefüllten Kleiderschrank zurückbleibt, hat man eine Reise angetreten, ohne das Ziel zu erreichen.
Tipps für die nächste Reise
Ich wiederhole mich vielleicht, wenn ich sage, daß unsere Szene das wird, was wir daraus machen. Das WGT ist ein fester Bestandteil der Szene, es für sich zu formen, liegt in der Hand jedes einzelnen. Wir sollten uns aufregen, wenn uns etwas stört und uns freuen, wenn uns etwas gefällt. Das stillschweigende Hinnehmen und innerliche Begraben „seiner“ Szene kann man nicht hören. Wie sollen es denn die, die wissen wollen, was nicht „richtig“ ist, es besser machen? Wie soll man entscheiden, wohin man reisen möchte, wenn man die möglichen Ziele nicht kennt?
Über die möglichen Ziele macht sich Mandy Violetta Gedanken: „Das Programm ist vielseitiger geworden und lockt verschiedene Interessengruppen, das gefällt mir am meisten. Negativ hingegen finde ich die Entwicklung des ‚Festivalfeelings’. Bei vielen ist der Spaß am Festival an sich verloren gegangen. Stattdessen müssen die teuersten Designeroutfits aus London präsentiert werden, in der Hoffnung ein Fotograf hält dies fest. Das war früher noch ganz anders.“
Und so sieht auch Marquise de Noir manche Entwicklungen kritisch: „Was mich persönlich sehr stört, ist das ‚Auffallen um jeden Preis’. Ich spreche dabei nicht von ausladenden barocken Roben, vollständig in Lack gehüllte Gestalten, Cybergothics oder aufwändigen Steampunk-Konstruktionen, das sind alles Teile der schwarzen Szene. Aber Menschen im rosa Hasenkostüm oder Damen, die im Evakostüm durch Leipzig marschieren, damit sie um jeden Preis auffallen – das hat für mich nichts auf so einem Festival zu suchen.“

(c) Markus Rietzsch – Pfingstgeflüster
Elegante Roben, aparte Details, perfekte Frisuren und Schminke sind eine Augenweide. Viele Besucher und Zaungäste wollen dieses Bild konservieren. Selten genug wird dabei Anstand und Höflichkeit gewahrt. Was Nerois ärgerlich kommentiert: „Ich finde es weniger gut, daß immer mehr Schaulustige angezogen werden, daß man permanent im Kameralicht steht und man auch des Öfteren ungefragt gefilmt wird. Eigentlich ist das WGT für mich ein Festival, in dem ich mich ungehindert so geben und kleiden kann, wie ich bin, und keinesfalls eine Modenschau, in der man wie ein Tier im Zoo begafft und fotografiert wird. Leider hat sich das in den letzten Jahren verschlimmert.“
Erfreut zeigt sich Luscinia Lullaby über die schon angesprochene Ausweitung des Kulturprogramms. Doch daneben fand sie „die Überfüllung des Heidnischen Dorfes Samstag und Sonntag wirklich schlimm“. Enttäuscht stellt sie fest, daß dies „nichts mehr von seiner eigentlichen Gemütlichkeit“ hat und eine größere Bühne und der Verzicht auf einen Besucherstop hier sicher nicht hilfreich sind.
Auch Vampy hat ein paar unangenehme Erfahrungen gemacht: „Leider habe ich den Eindruck, daß sich dieses Jahr, trotz der gestiegenen Preise, das Angebot an guten Bands verkleinert hat. Und die Bands, die viele sehen wollten, waren oft in so kleinen Locations untergebracht, daß es einfach viel zu überfüllt war. Da war die Organisation in den letzten Jahren viel besser. Außerdem finde ich es sehr schade, daß mittlerweile einfach jeder überall reingelassen wird. Ich meine, so, wie ich aussehe, werde ich nicht in… sagen wir ‚Prollclubs’ reingelassen. Was machen dann also die Prolls im Darkflower? Richtig: dumm glotzen, Stress anzetteln und Mädels betatschen. Das ist wirklich schade und sollte sich dringend wieder ändern.“ Doch sie schließt ihren Gedanken wohlwollend ab: „Es gibt natürlich auch viel Positives: das kulturelle Angebot ist wirklich sehr schön und man trifft einfach nirgendwo anders so viele tolle Menschen.“
Das Wave-Gotik-Treffen ist eine Reise. Die Organisatoren bringen uns an unbekannte und sehenswerte Orte, die viele Fahrgäste fasziniert betrachten. Doch wenn man durch die Abteile streift, fällt auf, dass sich immer weniger Fahrgäste unterhalten und viele damit beschäftigt sind, sie um ihre Erscheinung zu bemühen. Wohin es geht, wie das Ziel heißt und was einen dort erwarten könnte, spielt offenbar eine untergeordnete Rolle. Für die einen wäre es vielleicht wichtig, von ihren Reisen zu erzählen, aus sich herauszugehen und zu zeigen, dass jeder ein Ziel haben kann. Für die anderen ist vielleicht wichtig die Lust am Zuhören zu entdecken, mit anderen ins Gespräch zu kommen und eigene Ziele zu entdecken. Viele Besucher zeigen, dass sie genug Leidenschaft besitzen selbst etwas beizusteuern und ausreichende Neugier mitbringen, sich für ihre eigene Reise inspirieren zu lassen.