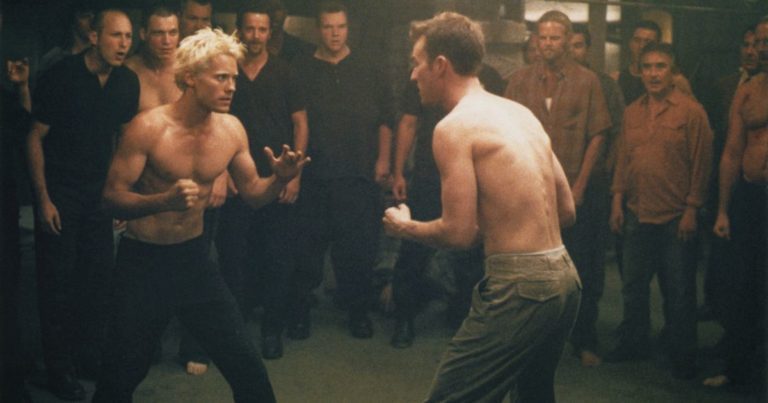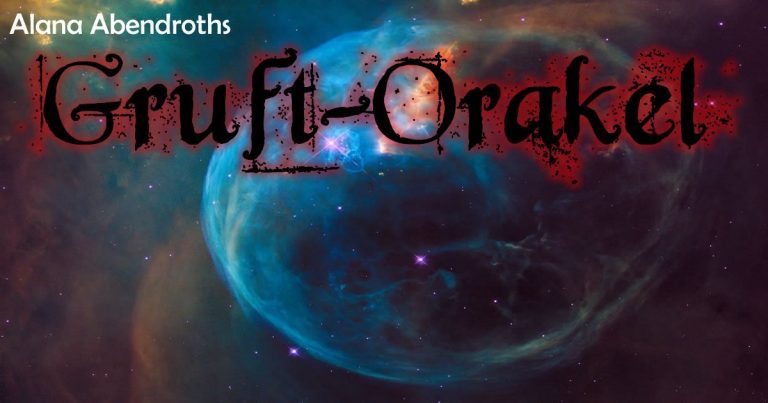Das Ende ist nah! Vertrauen wir den Aussagen der Virologen und meinem daraus resultierenden Bauchgefühl, steht das Ende der Pandemie unmittelbar bevor. In Großbritannien und Dänemark hat man längst alle Einschränkungen in den Wind geschossen und auch einige andere Länder ziehen nach. Okay, die Briten sind jetzt kein Maßstab, gemessen an dem Verhalten von Regierungschef Boris Johnson haben die schon länger aller Hüllen fallen lassen. Wahrscheinlich warten wir, die vorsichtigen Deutschen ab, ob Dänemark in den nächsten Wochen untergeht und ziehen dann nach. Bei ARTE lief derweil ein Blutbad im Programm, die vermutlich eine der vielen Verschwörungstheorien der Schwurbler auf den Bildschirm brachte. Die Welt ist von hirnlosen Zombies überrannt, die verbliebenen Menschen bekriegen sich gegenseitig und wer nicht aufpasst, wird gefressen. Ich bin mir sicher, das habe ich auf irgendeinem Plakat einer Demo so gelesen. :-)
Sorry, doch kein Blutbad bei ARTE! Für Horrorfans überraschend war die Tatsache, dass am 28. Januar der Kultschocker „Zombie 2 – Das letzte Kapitel“ ungeschnitten im Programm laufen und in der Mediathek zu sehen sein sollte. Der Film ist schließlich seit 1988 indiziert, seit 1990 sogar bundesweit beschlagnahmt, weil er – laut den Behörden – sogar einen Straftatbestand darstelle. Der Sender verteidigte sich „Auf Nachfrage beim Sender antwortete eine Sprecherin, dass der Film nicht mehr indiziert sei, weil er von der freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) ein „Ab-18-Logo“ erhalten habe, wie es auch auf einer im Netz angebotenen DVD zu sehen sei.“ nahm den Film aber trotzdem aus dem Programm. Gut so, denn wie sich herausstellte, handelte es sich, „bei der im Netz auf DVD angebotenen Fassung um eine Fehlkennzeichnung“, wie eine Sprecherin der Prüftstelle bestätigte. Aber ganz so schlimm ist der Verlust nicht, so ein Zombie-Klassiker hat trotz gutem 80er-Sound, viel Filmblut und kunstvollen Zombie-Masken nicht viel zu bieten. Jedenfalls nicht für den Otto-Normal-Gucker.
Bereits vor ein paar Wochen hat der US-Musikverlag „Warner Chappell Music“ die Rechte an allen David Bowie Songs erworben. Angeblich einigte man sich mit den Erben des 2016 verstorbenen Musikers auf rund 250 Millionen Dollar. Wahnsinn. Damit man die Kohle jetzt wieder reinholt, findet sich neuerdings im Trainings-Song-Katalog von „Peleton“ eine Auswahl an Bowie-Songs und diversen Remixen seiner größten Hits. Ob sich Bowie im Grab umdreht oder selbst aufs Geisterfahrrad steigt? Das Verkaufen von Musikrechten macht gerade sowie die Runde. Bruce Springsteen, ZZ Top, Tina Turner, Bob Dylan und Paul Simon haben ihre Songs auch schon für hunderte Millionen Dollar veräußert. Der Rubel muss rollen.
Am Rande einer nicht angemeldeten Corona-Demo in Wandlitz, ist Boris Pfeiffer, ehemaliges Mitglied der Band In Extremo verstorben. Wie die Freie Presse berichtet, starb er eines natürlichen Todes, nachdem er bei der Demonstration eine Polizeikette durchbrechen wollte. „Polizisten stoppten ihn und stellten seine Personalien fest. Danach habe er seinen Weg fortsetzen können. Kurz darauf sei der Mann auf dem Weg zu seinem Auto zusammengebrochen, sagte eine Polizeisprecherin. Er starb wenig später im Krankenhaus.“ Erst im Mai 2021 verließ Pfeiffer die Band nach rund 26 Jahren Bandgeschichte. „Pfeiffer hat sich dazu entschlossen, andere Wege zu gehen und wird ab sofort nicht mehr Teil der Band sein. Über die vielen Jahre der Zusammenarbeit verändern sich Lebensumstände, Sichtweisen und Prioritäten“, hieß es.“ Jetzt ist er überraschend gestorben, die ehemaligen Bandkollegen zeigten sich in einer Stellungnahme auf Facebook schockiert. „Bestürzt und mit Bedauern haben wir vom Tod unseres langjährigen Weggefährten Boris erfahren. 24 Jahre gemeinsam auf der Bühne waren mehr als nur ein Moment.“
Nachdem einige Künstler, wie beispielsweise Neil Young, ihre Musik bei Spotify löschen ließen, reagiert das schwedische Unternehmen Spotify nun. Hintergrund der Löschung waren erfolglose Beschwerden gegen den Podcast des umstrittenen US-Comedian Joe Rogan, der offenbar Falschinformationen über das Corona-Virus verbreitete, „Neil Young hatte vor einigen Tagen seine gesamte Musik von der Streaming-Plattform entfernen lassen. Der 76-Jährige hatte Spotify zuvor erfolglos aufgefordert, den Podcast des umstrittenen US-Comedian Joe Rogan zu entfernen. Er und Mitchell warfen Rogan vor, Falschinformationen über das Coronavirus zu verbreiten. „Spotify ist zu einem Ort der potenziell tödlichen Desinformation über Covid geworden“, kritisierte Young.“
Am 8. Februar werden in London die Brit-Awards verliehen, die als „hippere Schwester“ der Grammys bezeichnete Veranstaltung macht nun vor, was vielleicht bald zum Standard werden könnte. Geschlechterneutrale Kategorien. Das bedeutet in der Praxis, dass es Preise nicht mehr als male / female bezeichnet werden, sondern neue, geschlechtsneutrale Kategorien das Portfolio erweitern. „Artist of the Year“ und „International Artist of the Year“. Allerdings birgt das in der Praxis einige Probleme: „Die ersten Ansätze führen bei den 2020er-Awards dazu, dass in den gemischten Kategorien für britische Musik in den Segmenten „Album“, „Band“, „Song“ und „New Artist“ nur eine einzige (!) britische Frau vertreten war. Auch so kann ein gut gemeinter Gleichstellungs-Schuss nach hinten los gehen.“ Bei Deutschlandfunk-Kultur wird daher völlig richtig betitelt: „Längst überfällig oder vollkommen wirkungslos?“ Wie seht ihr das?
Schon Mitte des 19. Jahrhunderts zockte man gutgläubige Menschen mit Fake-Bildern ab. Mit einfachen Tricks – die heute wohl leicht zu durchschauen wären – ließen selbst ernannte Geisterfotografen Verstorbene auf Bilder auferstehen. „Sir Arthur Conan Doyle zweifelte keine Sekunde lang: Bei der Erscheinung, die auf dem Foto erschienen war, konnte es sich nur um seinen Sohn Kingsley handeln. Aber wie war das möglich? Der Junge war im Ersten Weltkrieg gefallen – und zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits seit etwa zwei Jahren tot. Doyle glaubte fest daran, dass der Fotograf es möglich gemacht hatte: Urheber der Aufnahme war der Brite William Hope, in Großbritannien bekannt als Lichtbildner, der auf seinen Bildern Verstorbene sichtbar machen konnte.“
Viel passiert in dem Werbespot nicht, Lindemann isst als Karl Lagerfeld verkleidet einen veganen Burger. Die Botschaft überlässt der Rammstein-Frontmann, der freie Hand bei der Gestaltung des Spots hatte, dem Zuschauer. „Dass Lindemann als Lagerfeld auftritt hat auch etwas Ironisches. Schließlich verwendete der Modedesigner in seinen Kollektionen über viele Jahre Pelz und Leder. Erst im letzten Jahr launchte die Marke Karl Lagerfeld eine vegane Taschenkollektion. Im Jahr 2020 gab die Marke bekannt, auf Wildtierleder zu verzichten.“
https://youtu.be/qDpXMsydYSk
Cave ist kein Musiker oder Autor, sondern eine Person. Aha! Diese Lebensweisheit wirft uns gebürtige Australier entgegen, als wir den Trailer einer neuen Doku starten. Vielleicht ist das so im Alter. Da tritt man einen Schritt zurück, betrachtet sein Leben und versucht sich aus jeder Schublade zu winden, damit das Lebenswerk auch ja das ganze Leben erfasst.